Außergewöhnliche Umstände erfordern außergewöhnliche Maßnahmen.
So wie ein Stromausfall im Frankfurter Nordend kurz vor Weihnachten dies getan hat….
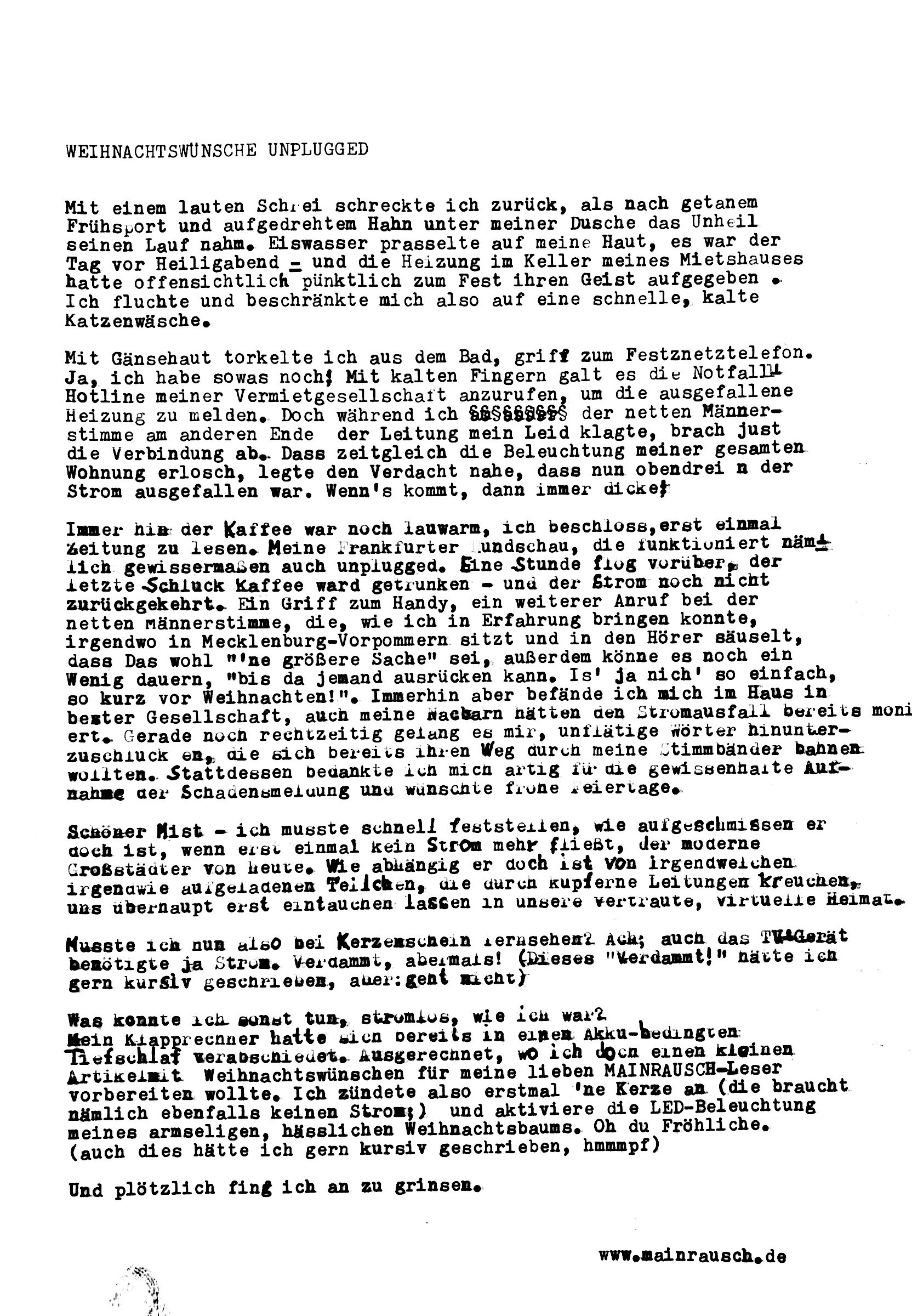
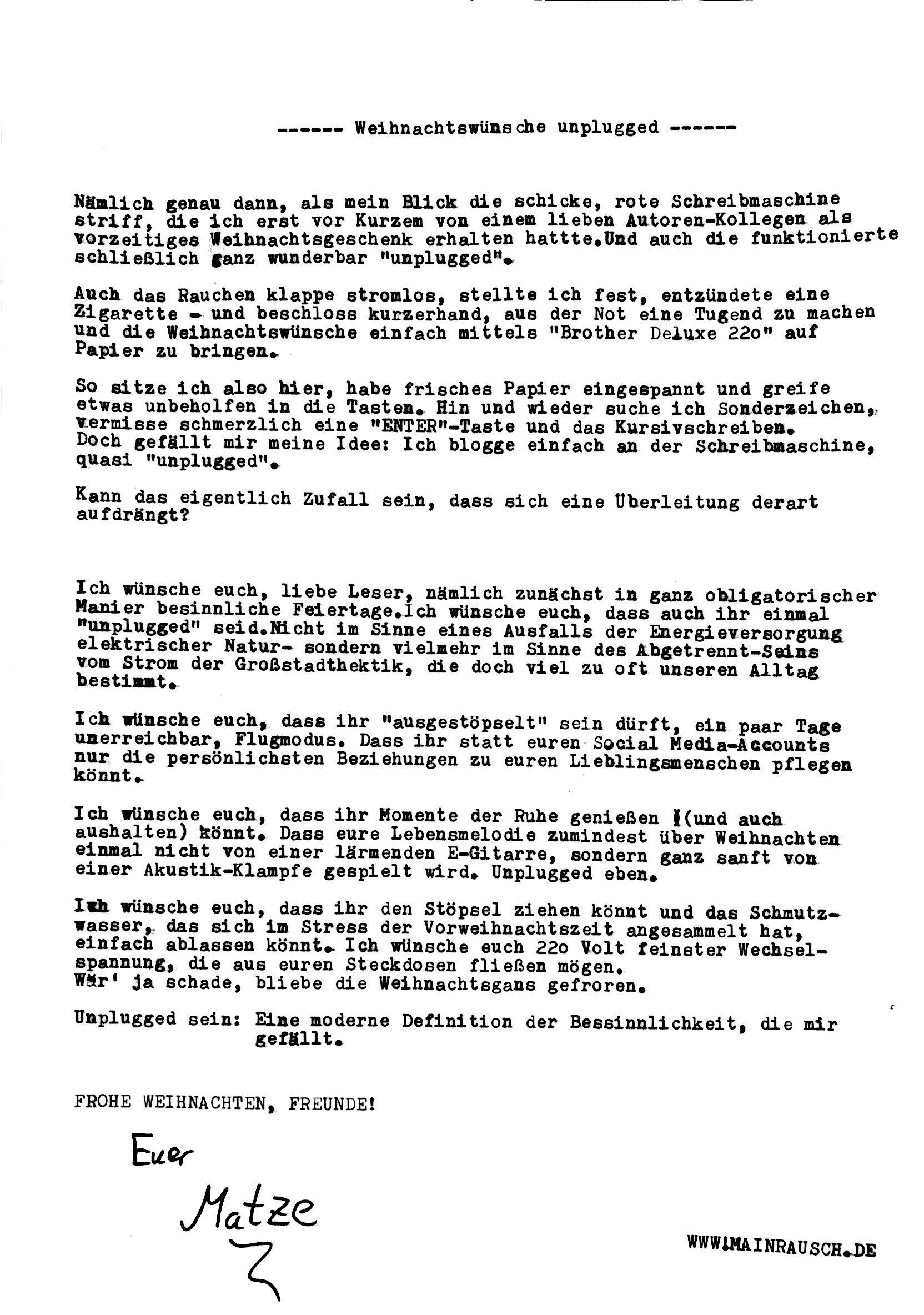
Demnächst dann wieder digital – so der Strom will…

Außergewöhnliche Umstände erfordern außergewöhnliche Maßnahmen.
So wie ein Stromausfall im Frankfurter Nordend kurz vor Weihnachten dies getan hat….
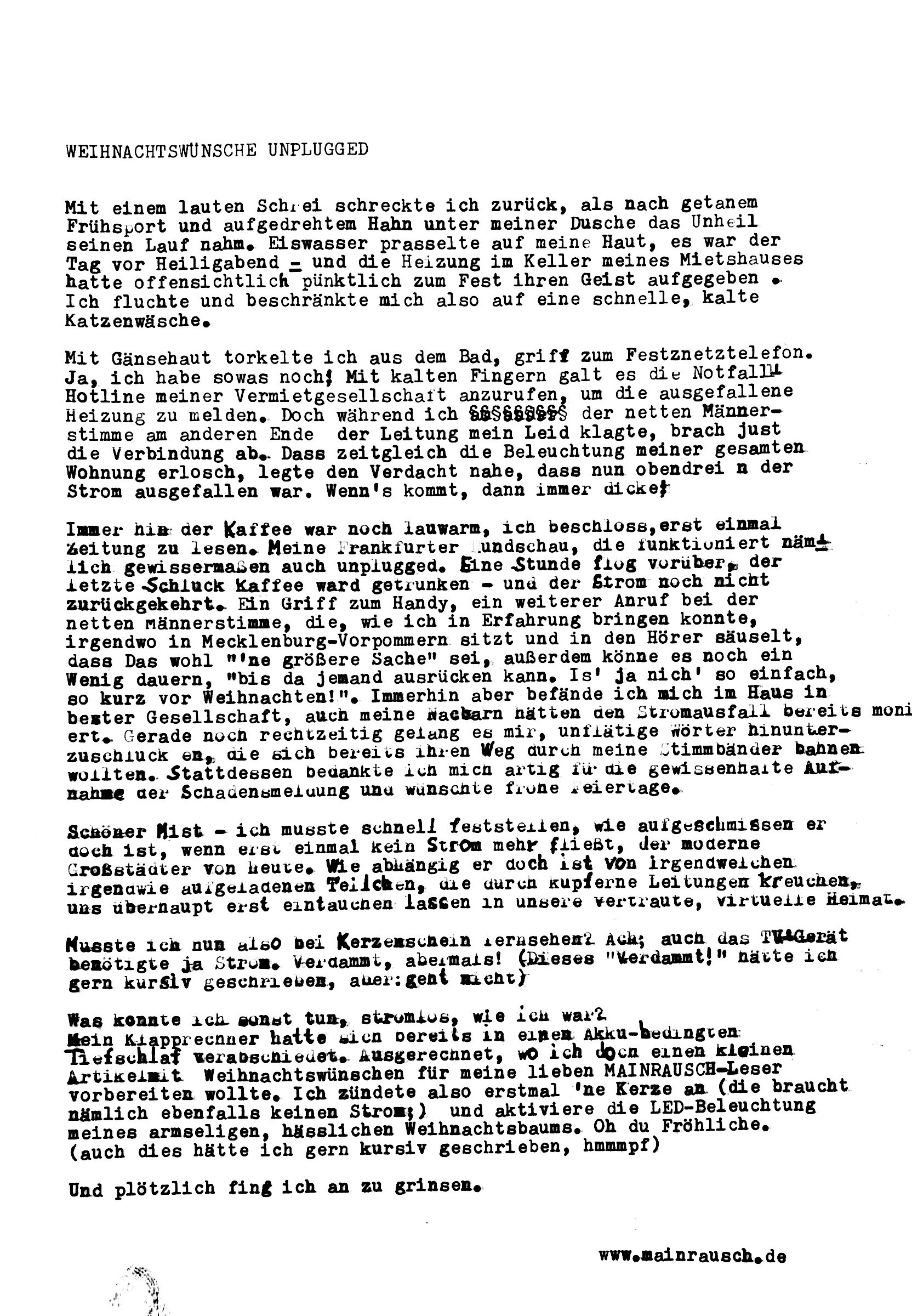
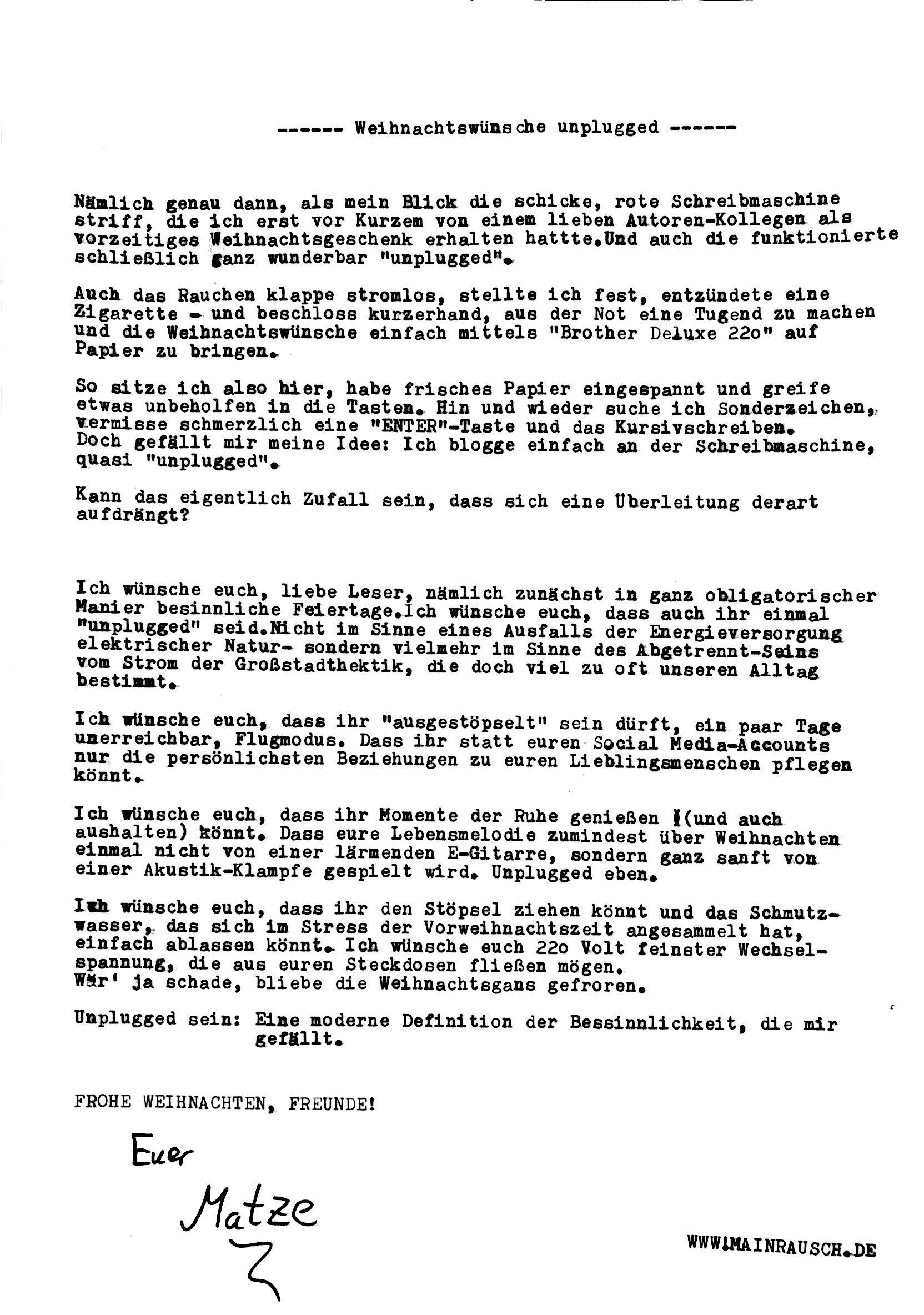

Na, habt ihr schon entnervt die Augen verdreht, als ihr den Titel dieses Beitrags gelesen habt? Es ist Dezember, Vorweihnachtszeit – und neben “Last Christmas” im Radio wird von jedem drittklassigen Fernsehsender ein Rückblick auf das bald vergangene Jahr präsentiert.
Und nun kaut also auch der Matze noch lang und breit sein Jahr 2017 durch? Na, aber sicher doch! Weil’s ihm persönlich einfach wichtig ist, weil kurzes Innehalten und Resümieren einfach wichtig ist. Und solltet ihr, liebe Leser, bis hierhin mitgelesen haben – dann könnt ihr meinem Blick zurück glatt folgen, oder?
365 Tage. Mancher nur Alltag, mancher Abenteuer. 365 mal Aufwachen, manchmal aufgekratzt vor Freude, manchmal auch gelähmt vor Sorge. Wo fängt ein Rückblick an, wo hört er auf? Vielleicht beginne ich bei den Vorsätzen, die ich vor ziemlich genau einem Jahr für 2017 gefasst und festgehalten hatte. Was wohl aus ihnen geworden ist?

Wenn ich heute lese, welch Entschlüsse ich vor ziemlich genau 12 Monaten getroffen hatte, muss ich schmunzeln. Ich wollte mich meinen Ängsten stellen, endlich einmal alleine ins Ausland verreisen. Gesagt, getan – das neue Urlaubsjahr läutete ich mit einem kleinen Städtetrip nach Budapest ein. Alleine, versteht sich! Ich war, das muss ich gestehen, ziemlich aufgeregt – aber verdammt froh und ein wenig stolz auf mich, als ich drei Nächte später wieder nach Hause kam.





Ja, ich hatte Blut geleckt:
Wollte ich mich mit drei Nächten beim ersten Mal nicht gleich überfordern, wurde ich wagemutig und plante, kaum zurückgekommen, eine Mietwagen-Rundfahrt an der Algarve. Abermals allein, eine knappe Woche lang. Flüge, Mietwagen, und Unterkunft hatte ich schneller gebucht, als ich nachdenken konnte. Zum Glück! Denn wären mir Zweifel gekommen, hätte ich diese wundervolle Zeit in Portugal niemals erleben dürfen. Nicht alles verlief reibungsfrei – doch gerade an den kleinen Unwägbarkeiten dieser Reise bin ich ganz sicher auch gewachsen. Hey, wer kann schon von sich behaupten, einmal ohne Sprit im Tank auf einer portugiesischen Autobahn liegengeblieben zu sein? Der erste Blick hinab ins Tal von Lissabon entschädigte jedoch für alles und wird für immer eingebrannt in meinem Gedächtnis bleiben.
Die nächste Reise unternahm ich dann doch lieber in Gesellschaft. Und zwar in allerbester, nämlich in Form meines Freundes Michael. Als wir Quedlinburg als Ziel auserkoren, wussten wir beide nicht recht, was uns erwartet. Dass es dort recht schön sein sollte, hatten wir beide bereits vernommen – nach vier Tagen im Harz konnten wir dies ausnahmslos bestätigen. Beim Wandern auf den Brocken herrschten sibirische Temperaturen und eine Sichtweite weit unter 30 Zentimetern: Die Fahrt mit dem Dampfzug durch die verschneiten Landschaften sowie die Spaziergänge durch Wernigerode, die Abende in ostdeutschen Kneipen sowie das wunderschöne Fachwerk in Goslar gehören dennoch zu meinen schönsten Erinnerungen an das vergangene Jahr.
Weil wir zusammen so viel Freude am Wandern hatten, waren wir unter anderem einige Zeit lang später noch im Vogelsberg unterwegs, erklimmten den Hoherodskopf – und sausten auf der Sommerrodelbahn wieder hinab. Freuden in der Sonne.
Auch auf dem Wasser waren wir unterwegs: Nachdem ich mich mit dem Fahrrad bereits bis Seligenstadt vorgearbeitet hatte, sind Michael und ich eines Tages im Frühjahr mit dem Ausflugsschiff von Frankfurt aus den Main hinauf bis Aschaffenburg gefahren, haben uns dort ein wenig die Stadt besehen.

Ach ja, und zwischendurch natürlich: Der Wäldchestag.
Dort ein nettes Mädchen kennengelernt, spontan zusammen eine Woche in Kroatien verbracht. Wie schade, dass ich erst im Jahr 2017 erfahren durfte, wie blau Wasser sein kann!
Jetzt, im Dezember dagegen, waren wir nicht mehr in Tanktop und Bermudashort zusammen unterwegs. Ein Kurzurlaub in Krakau in der Vorweihnachtszeit – auch bei Kälte eine wunderschöne Stadt.
Mein Reisejahr 2017 kann ich also persönlich voll und ganz als erfolgreich verbuchen. Ob alleine oder in Gesellschaft – ich hab’ das Abenteuer gesucht und es gefunden. Und klopf’ mir dafür mal auf die Schulter!
Mehr offline Leben. Den Tag zu genießen lernen, selbst wenn er manchmal schwieriger auszuhalten ist als die Nacht. Weil er ehrlich ist, auch wenn er manchmal schmerzt: Dies war ein weiterer meiner Vorsätze. Also: Hobbies mussten her.

Ich bin Freund der Bewegung, also lag es nur allzu nahe, mein Fahrrad öfters auszuführen. Auch und insbesondere allein. Und was war ich unterwegs! Ob durchs Rodgau, die Wetterau oder gleich an den Mittelrhein: So einige Kilometer hab’ ich runtergerissen. So einige Kilometer, die leider gleich zwei Mal im Krankenhaus endeten – ein Mal sogar mit gleich drei gebrochenen Rippen und einer Anzeige. Ob ich 2018 ein paar Tage hinter schwedischen Gardinen verbringen werden darf? Wir werden sehen! Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, auch das Frankfurter Umland endlich einmal ausgiebig zu erkunden.


Doch nicht nur mit dem Fahrrad war ich unterwegs; auch das Wandern habe ich für mich entdeckt. Ich bin nun in einem Alter, in dem man – so glaube ich – eine Einladung zur wüsten Feierei ausschlagen darf, weil man am nächsten Tag zu wandern gedenke. Doch musste ich erst lernen, Sätze wie: “Ich ziehe nicht mit weiter, denn ich mag morgen früh fit für einen Tag in der Natur sein” zu formulieren. Spießig gelle? Auch, wenn mir eine solche Absage oft nur schwer über die Lippen ging – bereut habe ich die Touren durch Taunus, Pfalz und Bergstraße kein einziges Mal. Zwoachtzehn gerne mehr davon!
Nicht, dass ich nur verreist, am Wandern oder mit dem Fahrrad unterwegs gewesen wäre. Auch der Musik habe ich mich nach Jahren erstmals wieder gewidmet. Nun ja, “Musik” mag übertrieben sein – zumindest habe ich meine Gitarre einmal wieder in der Hand genommen und entstaubt. Mir ein paar wenige Akkorde in Erinnerung gerufen und munter drauflos komponiert. Was soll ich sagen, es hat mir Spaß gemacht – auch wenn ich nachweislich über keinerlei Talent verfüge. Doch ist “Spaß haben” nicht eine Legitimation für alles, was ein Mensch so tut?
Zurück zum Hedonismus also, zurück zur Musik: Unter dem Titel “Talentfrei Musizieren” habe ich mittlerweile gleich mehrere Lieder komponiert und auf die Trommelfelle der wehrlosen Zuhörerschaft losgelassen. Mal laut, mal traurig, mal nachdenklich, mal gänzlich sinnbefreit: Nur Frankfurt war stets kleinster gemeinsamer Nenner meiner musikalischen Anschläge. Auch dem Goetheturm konnte ich zuletzt ein fragwürdiges Andenken erschaffen…
Mein größter Vorsatz für das kommende Jahr allerdings war es, viel mehr Dinge zum ersten Mal zu tun. Mich selbst öfters neu zu erfinden. Und was soll ich sagen? Dieser größte Vorsatz sollte auch zu meinem größten Glück im Jahr 2017 werden. Hätte mir noch vor 12 Monaten jemand erzählt, was ich dieses Jahr alles zum ersten Mal hätte machen würde – ich hätte ihm ganz sicher den Vollbesitz seiner geistigen Kräfte abgeschlossen.
Wie fange ich nun an? Vielleicht am besten chronologisch, nämlich mit dem Blogger-Stammtisch Frankfurt, den ich im Januar diesen Jahres ins Leben rief. Beim ersten Treffen war ich selbst überrascht von der großen Resonanz – und durfte ganz wunderbare Bekanntschaften schließen, wurde auf eine großartige Art und Weise inspiriert. Auch eine Freundschaft ist aus diesen Bekanntschaften entstanden – wer hätte das gedacht? Die Behauptung des “Merkurist Frankfurt”, Frankfurts Blogger-Szene sei de facto nicht existent, die konnte ich jedenfalls im Interview widerlegen.
Es war dann im Sommer, als mir ein Freund von einem neuen Stadtmagazin berichtete: “Frankfurt, du bist so wunderbar”. Mit der festen Absicht, dieses “Hipster-Blatt” auf diesem Blog zu zerreißen, erwarb ich ein Exemplar – und stellte fest: Hey, da steckt ja eine Menge Herzblut drin für meine Stadt!

Als ich hierzu einen Artikel veröffentlichte, konnte ich nicht ahnen, dass sich nur wenige Tage später die beiden wunderbaren Menschen bei mir meldeten, die mit ihrer Agentur hinter der Publikation stecken. Einem Treffen im Sonnenschein im Café Sugar Mama folgte das prompte Angebot einer Zusammenarbeit. Zwei Nächte später war ich mir sicher: Nein, das möchte ich nicht ausschlagen. Und heute bin ich unendlich froh darüber, Teil des großartigen Teams zu sein, welches so viel Herzblut in Blog und Magazin fließen lässt. Als ich zum ersten Mal meine eigenen Texte in Form einer Zeitschrift in einem Bahnhofskiosk liegen sah, war das jedenfalls ein ganz besonderer Moment für mich.
Bleiben wir bei den besonderen Momenten:
Dass ich selbst unglaublich gerne an PubQuiz-Veranstaltungen teilnehme, mich dabei aber nur selten mit Ruhm bekleckere, war mir schon länger ein Dorn im Auge. Wie schön wäre es doch, gäbe es ein PubQuiz allein für Frankfurt-Fragen, so dachte ich mir – und sorgte kurzerhand dafür, dass ein solches stattfindet.
Als Organisator und Moderator brütete ich nächtelang über den Fragen, und als ich eines Abends im Herbst vor den restlos ausgebuchten Tische des “WIR KOMPLIZEN” stand und über 60 Ratefüchse begrüßen dürfte, war ich wahrlich aufgeregt. Das Quiz hat mir als Moderator große Freude bereitet, und ich kann bereits jetzt verraten: Es wird im neuen Jahr eine Neuauflage geben!

Am Ende der Veranstaltung, als Gewinner gekürt und mit Preisen gesegnet waren, sprach mich eine Teilnehmerin an: Dagi sei ihr Name, sie sei begeisterte Leserin meines Blogs. Und freue sich, mich einmal kennen zu lernen… Huch! Ich glaube, ich wurde ein wenig rot im Gesicht. Wir blieben in Kontakt, irgendwie – erst beiläufig, später folgte eine schöne Radtour durch den Spätsommer. Und irgendwann die Frage, ob ich denn nicht einmal Gast in ihrer Sendung auf Radio X sein wollte. Welch eine Frage: Na klar wollte ich! Einmal selbst Radio zu machen, meine Stimme auf Kurzwelle übers Sendegebiet wabern zu lassen – das war schon immer ein Traum von mir. Offensichtlich hab’ ich mich auch recht wacker geschlagen, denn meiner Premiere am Mikrofon sollte bald ein zweiter Auftritt folgen. Dagi, dich kennengelernt zu haben, ist eine unendliche Bereicherung! Nicht nur, weil ich seitdem gleich viel weniger Angst vorm Älterwerden habe.
Meine Gastauftritte im Radio stellen da ein anderes kleines Highlight fast in den Schatten: Auf einem meiner Blogger-Stammtische lernte ich einen netten, kreativen Kerl kennen, den ich mittlerweile in meinen Freundeskreis aufnehmen durfte. Unter anderem pflegt dieser nette, kreative Kerl nämlich seinen eigenen Podcast – und auch in diesem durfte ich zu Gast sein. Meine Wohnung wurde vorübergehend zur Podcast-Sendezentrale, das Ergebnis dann – nun ja. Spaß hat’s in jedem Fall gemacht!

Nicht nur, dass ich es in diesem Jahr auf verschlungenen Wege sowohl auf Papier als auch ins Radio gepackt hätte: Einer nächtlichen Bewerbung bei einer Sendung des hessischen Rundfunks folgte ein Casting, folgte eine Zusage. Mehr darf ich leider aufgrund vertraglicher Verpflichtungen noch nicht verraten – seid einfach mal gespannt auf das neue Fernsehjahr! 😉
Kurzum: Wahnsinn, was ich alles zum ersten Mal gemacht habe. Wahnsinn, welch zauberhafte Möglichkeiten sich ergeben können – wenn man den Dingen einfach ihren Lauf gewährt….
Doch nicht, dass dieses Jahr ein einziger Zugewinn gewesen wäre. Im Gegenteil, so einige Verluste haben meine Stimmung oftmals getrübt, mich traurig und zurückgelassen fühlen lassen.
Dass meine liebste Kellnerin ihren Dienst in meinem liebsten Café quittierte, sollte nur ein Anfang sein. Lange war es abzusehen, im Spätsommer des Jahres nun Realität: Mein Freund Michael sollte Frankfurt verlassen, um in Berlin ein neues Leben zu beginnen. Und wie das eben so oft ist, wurde mir die Bedeutung einer solchen Freundschaft erst dann in ihrer vollen Größe bewusst, als unsere Treffen rar wurden, wir uns nicht mehr spontan in der Nachbarschaft begegnen konnten.
Dass Herr Oberbürgermeister Feldmann meinen offiziellen Antrag zur Benennung nach einer Straße nach meinem Freund Michael zwar ablehnte, mir aber dennoch persönlich antwortete, freute mich – als kleines Abschiedsgeschenk konnte ich in einer Nacht- und Nebel-Aktion immerhin noch eine “Michael Nickel”-Bank im Stadtbild etablieren, auf der ich meinen Freund zum Ehrenbürger unserer Stadt erklärte. Habt ihr sie schon entdeckt…? 🙂

Doch es sind sind nicht nur die unfreiwilligen Verluste, die mein Jahr 2017 prägten. Einige Trennungen habe ich ganz bewusst vollzogen, wenn auch oft nicht ohne Bauchschmerzen. “Ballast abwerfen”, so das Stichwort – und auch sogenannte Freundschaften hatten irgendwann eine solche dargestellt. Auch wenn ich mir dies lange nicht hatte einstehen wollen.
Ich bin einige Stunden lang tief in mich gegangen, habe mir überlegt: Welche Menschen in meinem Leben nehmen mehr, als sie mir geben? Wer raubt mir Zeit, statt mich ebenso zu inspirieren? Auf wen kann ich zählen, wenn es mir schlecht geht? Es fiel mir nicht leicht, als ich so einige Freundschaften kündigen musste. Heute fühle ich mich oftmals alleine, aber eben auch: Frei von Ballast und unabhängig. Lieber fühle ich mich hin und wieder einsam, als mich anderen anzubiedern. Dieser Entschluss steht, wird es auch 2018 tun. Punkt, aus, Ende.

Verloren, so will ich an dieser Stelle nicht verschweigen, hab’ ich in recht schmerzhafter Art und Weise auch meine Weisheitszähne. Und überhaupt, beim Zahnarzt war ich so manches Mal: Auch eine erste Wurzelbehandlung hatte ich über mich ergehen lassen. So hatte ich das mit den Dingen, die ich zum ersten Mal erleben will, dann irgendwie nicht gemeint. Aua.
Doch nicht nur Verluste gab es zu verzeichnen in diesem Jahr; im Gegenteil: So Einiges ist innerhalb der letzten zwölf Monate nämlich teils beträchtluch angewachsen. Und hiermit meine ich nicht nur meinen Erfahrungsschatzden, den ich Tag für Tag – mal mehr, mal weniger – erweitern durfte!
Nein, ich rede von:

Wann ist ein Jahr eigentlich ein gutes Jahr? Ich weiß es nicht.
Ich hab’ meine Traumfrau nicht gefunden, die Traumfigur nicht erreicht. Ich bin nicht reich geworden, habe mein Leben auch nicht anderweitig auf den Kopf gestellt. Aber ich bin eben auch nicht in der Klapse gelandet (was nicht immer selbstverständlich ist!), habe beständig kleine Ziele erreicht. Habe mich Ängsten gestellt, meine Hobbies konsequent verfolgt. Mich von Ballast getrennt, an hinterlassenen Lücken gelitten.
Vor allem aber habe ich die wunderbare Erfahrung machen dürfen, dass sich die auch undenkbarsten Dinge entwickeln können, wenn man ihnen einfach ihren Lauf lässt. Solange man eben aktiv und präsent ist, versucht zu gestalten statt zu konsumieren. Ich will mich Dies möchte ich auch im Jahr 2018 beibehalten. Ich woll mich weiterhin konsequent von Dingen und Menschen trennen, die mich und mein Leben belasten, in welcher Form auch immer. Auch wenn es schmerzt. Ich möchte darauf vertrauen können, dass sich immer etwas ergeben kann, das ich heute noch nicht erahnen kann. Dafür will ich offen sein. Ich will darauf vertrauen, dass ich auch im neuen Jahr 2018 großartige Menschen kennenlernen werden darf, dass ich wieder unvergessliche Unternehmungen machen darf. Dass ich Freundschaften wertschätzen und pflegen kann. Und nicht zuletzt mag ich euch auch weiterhin eifrig berichten – vom Leben, Lieben & Untergehen in Frankfurt am Main. Die freudige Erwartung auf all das, was geschehen mag – die genieße ich jedenfalls schon jetzt…

“Beck’s, Beck’s Lemon oder Corona?”
Die Dame hinter der Bar lächelt mich breit an und erwartet meine Bestellung. Ich verziehe kurz den Mund. Alles nicht so meins. “Ein Beck’s klingt super!”, entscheide ich mich, platziere in gewohnter Manier mein Buch vor mir – und fühle mich ein wenig fehl am Platz.
Rechts neben mir versuchen sich drei Kerle in Hemd und Jacket, sich gegenseitig mit ihren sportlichen Leistungen zu beeindrucken. “Also ich war gestern nach Feierabend noch zehn Kilometer laufen!”. Herzlichen Glückwunsch, denke ich mir und nehme einen Schluck Beck’s.

Vor den großen Fenstern des “Legend’s” fällt der erste Schnee des Jahres, und ich frage mich, was ich hier eigentlich mache. Ich säße gar nicht hier, hätte ich mich nicht dabei ertappt, wie ich nach Dienstschluss fast blind und wie ferngesteuert in die U4 gestiegen wäre, um auf einen Feierabend-Schoppen in “Feinstaub” oder “NORD” vorbeizuschauen.
Gerade noch so konnte ich mir in Erinnerung rufen, dass es doch gut tue, hin und wieder die eingetreten Pfade zu verlassen. Auch nach Feierabend, versteht sich, oder gerade dann. Und es ist ja auch so: Insbesondere Frankfurt frohlockt mit schier unendlich vielen netten Bars und Kneipen für ein Kaltgetränk zum Feierabend. Alle Entscheidung ist da mitunter schwierig, und so neige auch ich eben dazu, immer wieder dieselben Orte aufzusuchen.
Doch heute, da wollte ich quasi todesmutig neue Wege beschreiten, endlich einmal ausbrechen aus dieser spätabendlichen Feierabend-Routine, woanders lesen, während Freunde schon schlafen. Mir selbst ein Bild von den Bildern aus den Stadtmagazinen machen. Ein bisschen frischer Wind konnte doch nicht schaden?
Statt in die U4 bin ich also auf ein Call-a-Bike gestiegen, eisige Novemberluft schadete kurzzeitig meinem Wohlbefinden. So war das aber nicht gemeint mit dem „frischen Wind“!
Als Ziel auserkoren wart das „Legends“, weil gefühlt jeder schon dort gewesen war – außer eben ich. Diesen Zustand wollte ich beenden, doch nun, wo ich hier sitze, fühle ich mich fremd.
Ich vermisse das „Zuhause“-Gefühl, welches man als Stammgast kennt. Ich vermisse die persönliche Begrüßung, das gerenseitigr Erkundigen nach dem jeweiligen Wohlbefinden. Vermisse das „Wie immer?“, vermisse den großen, sauren Apfelwein, der nach kurzem Nicken daraufhin vor mir abgestellt wird.
Vermisse all die Leute, die auch immer hier sind, die man eben kennt, sei es auch nur vom Sehen. Die Toilette blind zu finden, den Heimweg sowieso: Ebenfalls `ne dufte Sache. Doch sind es nicht gerade diese Annehmlichkeiten, die mich immer wieder an die selben Orte zogen, an die selben Theken trieben?
Ich leere mein Beck‘s und beschließe, nächstes Mal wieder ein anständiges Bier zu trinken. Mache der – wirklich sehr netten – Dame hinter dem Tresen deutlich, dass ich zu zahlen gedenke. Fische unbeholfen im Münzfach meines Portemonnaie herum – äh; was kostete der Spaß hier doch gleich? Oha, ja, gar nicht mal so günstig. „Stimmt so!“
Während ich nach Hause fahre, muss ich grübeln. Fuck yeah, ich hab‘ meinen Horizont erweitert – aber wäre ich in diesem Moment nicht glücklicher gewesen, wäre ich meinem Trott gefolgt, hätte ich die letzte Stunde in vertrauter Umgebung verbracht?

Nun, zumindest hätte ich wohl kaum „face to face“ gleich einer ganzen Armada von Ghettoblastern pinkeln können.
Ich habe frei (hurra!), ertappe mich nach dem Laufen frischgeduscht dabei, wie ich mich instinktiv auf in mein Stammcafé „Sugar Mama“‘ machen möchte.
Gerade noch rechtzeitig entsinne ich mich jedoch auf meinen Plan für den heutigen Tag: Ein Kumpel schwärmte neulich vom besten Cappuccino der Stadt, und den gebe es im „Anïs“, müsse ich mal probieren.
Dies galt es zu überprüfen; statt wie sonst an die alte Brücke sollte es heute also auf ins Ostend gehen. Frischer Wind und so, ihr wisst schon.

Ich trete ein, freue mich über die Wärme. Die zwischenmenschliche Wärme aber, die fehlt mir. Kein “Hey Matze, schön dich zu sehen!” zur Begrüßung, keine Umarmung. Kein “Setz’ dich schon mal!”, kein großer Kaffee mit Sojamilch, der mir serviert wird – ohne dass ich ihn bestellt haben müsste. Seufz.
Ich vermisse meinen Schaukelstuhl, mein Sofa – und sitze obendrein recht unbequem, auf diesem wackligen Metallstuhl im Ostend. Zwar ist man auch hier sehr nett zu mir, der Milchschaum meines Cappuccino (der wirklich ziemlich gut ist!) zeigt sogar einen Schneemann.
 Doch bin ich hier eben nur ein Gast unter vielen, Geschäftspartner, Kaffeetrinker. Und eben nicht: Wohlbekannter Stammgast.
Doch bin ich hier eben nur ein Gast unter vielen, Geschäftspartner, Kaffeetrinker. Und eben nicht: Wohlbekannter Stammgast.
Ich hab’ genug der Experimente. Schlürfe aus, steige wieder auf mein Fahrrad, um die neuen Ufer zu verlassen – und laufe gewissermaßen ein in meinen Heimathafen. “Hallo, Roberta!”, begrüße ich meine liebste Kellnerin in meinem Stammcafé. “Matze, wir haben schon auf dich gewartet!”, strahlt sie mich an. Und ich? Fühle mich ein wenig schlecht, wie ein untreuer Ehemann, der seine Gattin betrogen hat. Ich grüße all diejenigen, die auch immer hier sind und freue mich über den duftenden Kaffee, der mir gereicht wird. Schön, wieder zu Hause zu sein!
Die Vielfalt all der Cafés, Bars, Restaurants und Kneipen in Frankfurt lässt die Wahl leicht zur Qual werden. Ein ganzes Leben reicht wohl nicht, um überall einmal einen Kaffee getrunken, ein Stück Kuchen gegessen zu haben. Kaum hat man erstmal einen Laden gefunden, in dem man sich pudelwohl fühlt, kaum hat man sich erst einmal mühevoll durch hartnäckige Besuche den Status eines Stammkunden “erarbeitet” – da nagt schon wieder das schlechte Gewissen. Zumindest an mir.
Doch haben mir meine beiden Exkursionen der letzten Tage gezeigt:
Ich hätte nichts weiter verpasst außer das wohlige Gefühl, “zu Hause” zu sein.
Ich kann mich glücklich schätzen, meine liebsten Fleckchen Frankfurts bereits entdeckt zu haben – und nehme dafür künftig nur allzu gern in Kauf, all die anderen sträflichst zu vernachlässigen.
Stammgast zu sein: Das ist nicht langweilig, das ist ein großes Glück. Und ständig an denselben, schönen Orten rumzuhängen großartig!

Ach, was war das doch früher schlimm auf dem Dorf, in dem wir groß geworden sind! Ein jeder der zweitausendeinhundertachtzehn Einwohner kannte, grüßte und beobachtete sich. Uns natürlich eingeschlossen, sodass wir stets fürchten mussten, Teil des berüchtigten Dorfklatsches zu werden.
Wer ist neulich noch nach Mitternacht über hinuntergeklappte Bürgersteige marschiert, wer hat den sonntäglichen Gottesdienst versäumt, wer hat beim Fest der freiwilligen Feuerwehr nach dem zwölften Bier ein gar unflätiges Lied angestimmt? Wer hat mit der Pfarrerstochter techtelmechtelt, wer gar die Mülltonne abweichend vom amtlichen Müllkalender vor den Vorgarten gestellt? Und überhaupt, war dessen Rasen überhaupt akkurat gemäht – oder drohten Anzeichen der Verwahrlosung und somit neuer Stoff für Klatsch in der Schlange des einzigen Supermarkts im Dorf?
Ja, es hatte seine Gründe, warum wir alle irgendwann – ob zu Beginn des Studiums, oder zum Zeitpunkt des ersten Gehalteingangs – die Flucht in die Großstadt angetreten sind.
Wir alle haben uns danach gesehnt, in jener Anonymität zu versinken, die ein Großstadtleben verspricht. Gesehnt nach dem “Endlich-tun-und-lassen-was-ich-will”, nach unserer ganz persönlichen Freiheit.
Auch ich selbst bin diesem Reiz erlegen, sehnte mich danach, nurmehr Einer von Vielen zu sein. Unbeobachtet mein Ding machen zu können, was auch immer das auch sein sollte. So wie der Großteil meiner Generation, Stichwort: Landflucht.

Die Nachbarschaft? Das sind die, denen wir allenfalls höflich zunicken, wenn wir ihnen im Fahrstuhl begegnen. Das sind allenfalls diejenigen, die unsere Pakete entgegennehmen, während wir Überstunden schieben, um uns unsere Einzimmerwohnung im Szene-Viertel überhaupt noch leisten zu können.
Auch zwischen meiner eigenen Nachbarschaft und mir waren über Jahre hinweg die flüchtigen Begegnungen im Treppenhaus die einzigen Berührungspunkte. Die laute Musik von oben, das Schlangestehen am Müllcontainer. Das in meinem Flur herumstehende Paket, das die Dame aus dem Hinterhaus doch längst abgeholt haben sollte. Meine Nachbarschaft und ich, das war ein bloßes Zurkenntnisnehmen.
Vielleicht an diesem Nachmittag im Sommer, an dem ich – wie immer ein wenig spät dran – das Treppenhaus hinunter schoss, den Müllsack in der Hand. Und um ein Haar sie gekracht wäre, in die Frau aus “dem Zweiten”, die zusammengekauert auf einer Stufe saß.
Sie fasste sich an ihre Brust und atmete tief. War alles in Ordnung mit ihr? Offensichtlich nicht. “Können Sie kurz bei mir bleiben?”, fragte sich mich. “Mir ist gerade ganz komisch, ich habe Herzrasen und mir ist schwindelig”. Ich beugte mich zu ihr hinunter und kam in die Bredouille. Ich musste zum Dienst, und zwar pronto. Aber konnte ich deswegen ihr Hilfegesuch ignorieren, mit Scheuklappen von dannen ziehen? Keinesfalls.
Ich beruhigte sie, bevor ich ihr erklärte, dass ich es gerade ein wenig eilig habe. Ich bot ihr an, bei einem der Nachbarn zu klingeln. “Aber ich kenne doch niemanden hier im Haus…”, sagte sie skeptisch. “Tja”, dachte ich mir insgeheim, “ich auch nicht”.
Letztlich blieb ich bei ihr, bis es ihr besser ging. Ich rang ihr das Versprechen ab, den Krankenwagen zu rufen, sollte ihr Schwindel zurückkehren. Drückte ihre Hand und murmelte “Alles liebe!”, bevor ich sie alleine ließ. Zum Dienst kam ich natürlich zu spät.
Noch auf dem Weg zur Arbeit kam ich ins Grübeln:
Ist es nicht traurig, nicht den Hauch einer Ahnung zu haben, wer all die Menschen überhaupt sind, mit denen man sich immerhin den eigenen Lebensraum teilt? Keine Ahnung von den Geschichten zu haben, die sie zu erzählen hätten? Ja, nicht einmal zu wissen, wen man überhaupt um Hilfe bitten sollte, wenn man in Not steckt? Oder sich auch nur gerne eine Leiter borgen würde?
Welchen Stellenwert hat “Nachbarschaft” heutzutage überhaupt noch? Und wie viel Potential liegt ungenutzt in ihr brach? Nach reiflicher Überlegung bin ich mir sicher: Nachbarschaft kann mehr als Klatsch & Tratsch.
Bunte Zettel laden ein zum Sommerfest mit “Grillparty & Cocktails für die Nachbarn oder zum spontanen Nachbarschafts-Konzert. Ein Blick auf den allabendlich gut besuchten Matthias-Beltz-Platz bezeugt: Auch Abhängen an Trinkhallen scheint wieder en vogue. Statt nach Feierabend mit Kollegen in Szene-Bars zu posen, trifft man sich mit den Nachbarn auf ein Bier am Büdchen. Dort hinterlegt man ausrangierte Bücher, vielleicht freut sich ja ein Nachbar drüber. Und wenn zu Hause mehr ausgerümpelt wird als Bücher, wird eben kurzerhand ein Hof-Flohmarkt veranstaltet. Das Viertel gibt, das Viertel nimmt.

Auch im virtuellen Lebensraum scheint die Nachbarschaft wieder auf dem Vormarsch: Auf Facebook blühen Gruppen wie “Frankfurter Nachbarschaftshilfe”, Plattformen wie “nebenan.de” sind soziale Netzwerke allein für Nutzer einer räumlich definierten Nachbarschaft. Auch Apps wie “nachbarschaft.net” versprechen unkomplizierte Vernetzung und dem Nutzer schnelle Abhilfe, wenn er mal schnell ‘ne Bohrmaschine oder einen Hundesitter braucht.
Dabei haben erwähnte Plattformen haben längst den Sprung aus dem Internet heraus auf die Türschwelle der Menschen gewagt; zumindest in Form von breit gestreuter Werbung. So zog ich neulich neugierig einen kleinen Umschlag aus meinem Briefkasten – adressiert an “unsere liebe Nachbarschaft”, ergänzt um meine Anschrift. Den Umschlag aufgerissen, hielt ich ein nettes, kleines Kärtchen in den Händen – welches sich dann schnell als Werbung für die Plattform “nextdoor.de” entpuppte. Nun kann man über Postwurfsendungen geteilter Meinung sein: Doch dieser kleine Brief ist allemal Beleg dafür, dass hier nicht nur ein Bedürfnis entstanden ist, dass es zu stillen gilt – sondern mit dem gar ‘ne Menge Geld zu machen scheint.

Aus Neugierde hatte ich mich angemeldet und einmal umgeschaut in meiner virtuellen Nachbarschaft, die mir in echt so fremd ist. “Babysitter im Nordend gesucht”, lese ich da. “Dringend benötigt: Starker Mann mit Bohrmaschine”. Kaum zu glauben, dass es für solcherlei Belange heutzutage kommerzielle Online-Plattformen benötigt. “Auf eine schöne, lebendige Nachbarschaft in Frankfurt am Main” scheint jedenfalls nicht nur Werbe-Slogan , sondern gleichfalls Wunsch des urbanen Menschen.
Täusche ich mich also, oder ist da irgendwo in den Tiefen des Großstadtdschungels eine neue Sehnsucht nach dem Miteinander gewachsen? Erlebt die Nachbarschaft eine Renaissance? Eine Nachbarschaft,in der man einander kennt, sich mehr zu sagen hat als “Guten Morgen!” und “Entschuldigen Sie die Störung, aber Sie haben doch ein Paket für mich” ?

“Das Label der Urbanität ist hip geworden”
All diese Fragen möchte ich gern jemandem stellen, der sich damit auskennt.
Und wer sollte das schon besser als Doreen*? Die 27-jährige Frankfurterin hat urbane Kultur, Gesellschaft und Raum studiert und sich bereits in ihrer Master-Arbeit mit dem Thema “Nachbarschaft” befasst. Heute arbeitet sie in einem städtischen Projekt, welches die Aufwertung von Wohn- und Lebenssituation sowie die Stärkung des sozialen Zusammenhangs in ausgewählten Stadtgebieten zum Ziel hat.
Ich treffe Doreen am Luisenplatz im Frankfurter Nordend. Es ist ein lauer Spätsommerabend, der Platz noch gut gefüllt: Anwohner haben es sich gemütlich gemacht auf den Bänken und Stühlen, genießen die letzten Sonnenstrahlen mit Buch in der Hand oder kaltem Bier und Gesprächen. Und durchaus passender Ort also für die Fragen, die ich ihr stellen mag.
Gude, Doreen* !
Wir sitzen hier mitten im Nordend, dem urbanen Hotspot einer Stadt, die sich selbst auch gern mal eine Metropole schimpft. Welche Bedeutung hat “Nachbarschaft” überhaupt im großstädtischen Miteinander – insbesondere im Vergleich zu ländlichen Wohngebieten?
Nachbarschaft und Großstadt, das mag auf den ersten Blick nicht zusammenpassen – kein Wunder, schließlich leben oftmals in einer einzigen Straße mehr Menschen als in einem gesamten Dorf, die obendrein noch seltener in Kontakt stehen. Eine Stadt ist geprägt durch Menschen mit sehr unterschiedlichen Lebensstilen, von verschiedenen Kulturen und Kontoständen. Wo unterschiedliche Interessen aufeinander prallen da erscheint ein Miteinander zunächst nachrangig. Der urbane Raum hält eine Vielzahl von Angeboten wie Parties, Bildungsmöglichkeiten und Gesundheitsversorgung bereit. Da liegt der Gedanke nahe, eine Nachbarschaft dort sei überflüssig. Auf dem Lande besteht einfach auch eine grundsätzliche Notwendigkeit, sich zusammen zu schließen – ohne Dorffeste und Vereinsleben wäre da nämlich tote Hose!
Trotzdem rentiert sich eine gute Nachbarschaft auch innerhalb einer Großstadt. Vor allem dann, wenn Menschen selbst nicht über ausreichend Mittel verfügen, um an all den Angeboten teilzunehmen. Ich denke hierbei nicht nur an den Geldbeutel, sondern auch an den entsprechenden Gesundheitszustand oder Lebensumstand. Auch hier lohnen sich Symbiosen: Wenn die älte Nachbarin hin und wieder unentgeltlich auf das Kind ihrer anderen Nachbarin aufpasst, und diese dafür für sie einkaufen geht – dann profitieren beide Nachbarn. Noch wichtiger ist eine solche gegenseitige Unterstützung, wenn Familien weit entfernt leben. Und dies ist in Städten dann doch weit häufiger der Fall…
Das klingt für mich plausibel! Doch hast du gerade viel von hilfsbedürftigen Menschen gesprochen. Welchen Stellenwert hat denn eine funktionierende Nachbarschaft überhaupt noch für junge Menschen, die ein sehr eigenständiges Leben führen können?
Ich kann nicht sagen, ob man man das allgemeingültig sagen kann – nur, weil wir eben die “Generation Smartphone” sind. Der Stellenwert der Nachbarschaft für den Einzelnen einfach viel mit der derzeitigen individuellen Lebenssituation zu tun.
Mehr und mehr mache ich die Beobachtung, dass Veranstaltungen wie Flohmärkte oder Grillfeste ganz explizit als “nachbarschaftlich” gestaltet und beworben werden. Existiert vielleicht so etwas wie eine neue Sehnsucht nach der Nachbarschaft?
Mir persönlich fällt momentan vor allem eine Hochkonjunktur des Begriffs “urban” auf. Die Werbebranche scheint ihn als Synonym für Lebendigkeit, Vielfalt und Modernität schlechthin für sich entdeckt zu haben. Angefangen vom Lifestyle-Magazinen wie “Prinz: Das Magazin für urbane Lebenskultur” bis hin zu Automobilherstellern wie Nissan, die eines ihrer Fahrzeugmodelle beispielsweise mit dem Slogan “Nissan Micra: Das Stadtauto, das Konventionen bricht”.
Es ist in, Produkte mit dem Label der Urbanität zu versehen. Doch so hip der Begriff momentan auch sein mag, für viele Menschen ist er gleichzusetzen mit Anonymität und Einsamkeit. Ja, wir wissen diese Anonymität zu schätzen – und trotzdem scheint eine Sehnsucht nach dem nachbarschaftlichen Miteinander in den Köpfen zu existieren. Davon profitieren zur Zeit sogar ganze Online-Plattformen!
Sie erheben diese Sehnsucht zum Geschäftsmodell. Da wundert es kaum, dass in diesem Jahr erstmals ein “Deutscher Nachbarschaftspreis” verliehen wurde. Klingt erstmal nach einer tollen Sache – ist im Endeffekt aber lediglich eine Werbemaßnahme für die Plattform “nebenan.de”.
Das wusste ich selbst noch gar nicht! Wünschenswert, dass die Community solcher Plattformen tatsächlich von ihnen profitieren kann. Ich selbst habe bislang nie eine ausprobiert. Doch lass’ uns mal kurz zu dir kommen: Wie viel Wert legst du ganz persönlich auf deine eigene Nachbarschaft?
Ich selbst bin für mein Studium aus der tiefsten süddeutschen Pampa nach Frankfurt gezogen. Klar, die Anonymität der Großstadt habe ich erst einmal ausgiebig genossen. Doch schnell habe ich gemerkt: Es fällt schwierig, sich “zu Hause” zu fühlen, wenn man Tür an Tür mit Unbekannten lebt. Wir Großstädter sind Meister darin, Unangenehmes auszublenden und uns auf uns selbst zu fokussieren. Doch macht ein solcher Tunnelblick wirklich glücklich?
Ich beispielsweise habe mir angewöhnt, konsequent alle Ladenbesitzer und bekannten Gesichter anzulächeln. Seitdem fühle mich gleich viel wohler in meinem “Kiez”! Natürlich aber ist Lächeln kein Patentrezept für gute Nachbarschaft. Als ich mich nämlich mit meinem Nachbarn verkracht hatte, weil er gern mal ein wenig laut war – da half dann auch kein Lächeln mehr…
Zusammenfassend kann ich aber sagen:
Wer denkt, keinen Wert auf die Nachbarschaft legen zu müssen – der sollte mal bei 7% im Handy-Akku seinen Haustürschlüssel verlieren. Das kann ein echter Augenöffner sein! (lacht)
Danke dir für das Gespräch, Doreen! Ich sag’ dann mal: Auf gute Nachbarschaft!
Ja, auch ich merke, wie ich mich nach einer guten Nachbarschaft sehne. Wie oft wäre es schön, nach einem langen Arbeitstag noch ganz gemütlich auf einen Plausch beim Lieblings-Nachbarn vorbeischauen zu können, statt sich noch einmal auf den Weg in die Stadt zu machen, um Freunde zu treffen?
Auch die Weihnachtszeit steht mittlerweile vor der Tür. Ist denn ein vom und für den “Kiez” veranstalteter Weihnachtsmarkt nicht gleich um Welten besinnlicher als ein eiliges Schieben und Drängeln vor der Glühweinbude am Römerberg?
 Ich muss Doreen recht geben. Auch ich wünsche mir Nachbarschaft als eine wertvolle Symbiose, ein Geben und auch Nehmen.
Ich muss Doreen recht geben. Auch ich wünsche mir Nachbarschaft als eine wertvolle Symbiose, ein Geben und auch Nehmen.
Ich bin gern bereit, zu geben – weit mehr als nur meine Steckdose, wenn des Nachbarn Handy-Akku leer ist. Ja, ich wünsche mir ein wenig mehr Beschaulichkeit und Vertrautheit im oft so anonymen großstädtischen Gefüge.
Und damit scheine ich nicht alleine. Nachbarschaft hat Zukunft – da bin ich mir ganz sicher…
*Name vom Verfasser geändert
Für ein Projekt für das Stadtmagazin “Frankfurt, du bist so wunderbar” war ich neulich gemeinsam mit einer Kollegin auf der Zeil unterwegs, um 100 Frankfurter nach ihren Lieblingsorten zu befragen. Das war gleichermaßen aufregend, anstrengend wie aufschlussreich: Welche Orte die Befragten wohl nennen würden?
Am Ende haben wir ganze 65 verschiedene Lieblingsorte von den 100 Befragten genannt bekommen. Manche der Antworten haben mich schlicht verwundert (Die Zeil als Lieblingsort? Echt jetzt?), überraschend oft wurden allerdings auch Namen von Cafés & Bars genannt, die auch mein Herz haben höher schlagen lassen.
Doch sind auch Cafés und Bars letztlich nur Orte des Konsums. Es stimmt mich nachdenklich, dass offensichtlich vielen Frankfurtern als erstes Gastronomiebetriebe in den Sinn kommen, wenn sie an ihren liebsten Ort denken.

Wir kennen all die Szene-Cafés der Stadt, in denen wir mit Vorliebe herum-hipstern. Immer präsent sein, stetig am konsumieren, ein schneller Post auf Instagram.
Latte Macchiato, Pastrami & W-LAN: Fertig ist er, der Lieblingsort unserer ach so urbanen Generation. Nein, auch ich bilde hier nicht immer eine Ausnahme.
Umso schöner und überraschender aber war der Lieblingsort, den ich dem 17-jährigen Yannick entlocken konnte, der es sich auf einer Bank inmitten der Zeil gemütlich gemacht hatte. Ein netter Kerl, dessen Alltag vermutlich noch eher aus Klausuren denn aus 3rd-wave-coffee bestehen dürfte. Ohne lange nachdenken zu müssen verriet er mir nämlich ein ganz besonderes Fleckchen Frankfurts. Café, Szene-Bar oder Konsumtempel? Pustekuchen!
“Wann immer ich Zeit für mich brauche, fahre ich zu den Ruinen des alten Senders Heiligenstock und setze mich auf eines der verfallenen Fundamente. Von dort aus den Sonnenuntergang zu beobachten, ist ein wunderschöner Moment! Kennst du die Ruinen?”
Nein, ich kannte nicht. Zwar hielt ich mich bislang für recht bewandert, was meine Heimatstadt anbelangt – doch ich hatte keine Ahnung, wovon Yannick sprach. Die Ruinen einer alten Sendeanlage als Lieblingsort: Diese Antwort wich dann doch angenehm von denjenigen der vielen zuvor Befragten ab.
Wieder einmal ward meine Neugierde geweckt. Yannick versuchte sich bereitwillig an einer Wegbeschreibung zu den Ruinen: “Am Lohrberg vorbei, am alten Zollhaus links in Richtung Nidda, mitten auf dem Berger Rücken”.
Ich bedankte mich recht herzlich – und beschloss, diesen “Lost Place” schnellstmöglich auch für mich zu entdecken.
Die kurze anschließende Recherche ergab:
Der Sender Heiligenstock war von 1926 an in Betrieb und versorgte das Sendegebiet mit einer 122 Meter hohen Antenne mit Mittelwellenrundfunk, bis sie 1967 dann dem inzwischen ebenfalls eingestellten Sender Weißkirchen weichen musste. Die Antenne wurde abgerissen – übrig blieben Fundamente und die Ruine des Technikgebäudes…

Man mag es kaum glauben, doch auch im Jahr 2017 gibt es noch Orte, die nicht auf Google Maps verzeichnet oder auf Yelp gelistet sind. Als ich mich aufs Fahrrad schwinge, um den Überresten des Senders einen Besuch abzustatten, muss ich mich auf Yannicks Wegbeschreibung verlassen.
Bis zum alten Zollhaus finde ich ohne Probleme – doch wo genau nun links abbiegen? “Am Heiligenstock”; dieser Straßenname liest sich gut und zielversprechend. Der Oktober zeigt sich von seiner schönsten Seite, als ich auf schmalen Pfaden rolle, stetig Ausschau halte nach irgendwelchen Ruinen.

Ich erreiche Felder, der Blick reicht bis in den Taunus – nur irgendwelche Betonfundamente vermag ich auch nach einer knappen Stunde nicht zu entdecken. Dafür aber einen alten Mann, der sich seinen Weg quer über die Wiese bahnt. Ich spreche ihn an, wir kommen ins Gespräch.
“Der alte Sender?”, fragt er und schmunzelt. “Da sind Sie hier aber ganz falsch!”. Auf der falschen Seite zumindest, vom Friedhof, ich solle doch den Weg noch einmal zurück fahren. Dann auf die andere Seite des Friedhofes am Heiligenstock wechseln, und ich würde endlich fündig. Wir unterhalten uns noch ein wenig. Sein Hund sei gestorben, nun bleibe ihm nichts anderes übrig, als alleine seine Runden zu drehen. Aber frische Luft, die halte eben fit. Ich bedanke mich herzlich, trete wieder in die Pedale.
Eine weitere halbe Stunde späte weckt eine bunte, große Mineralwasserflasche erste Zweifel in mir, auf dem richtigen Weg zu sein. Hatte ich diese Flaschen-Statuen nicht immer in Bad Vilbel gesehen? Ein Ortsschild verfasst Gewissheit: Verdammt, ich bin zu weit. Und mittlerweile in Bad Vilbel gelandet. Ich ärgere mich und werde ungeduldig, doch aufgeben zählt nicht. Ich treffe einen weiteren Mann, diesmal mit Hund.
Er verspricht, mir weiter zu helfen. Wieder zurück, dann aber doch bitte rechts halten und querfeldein. Abermals ein großes Dankeschön, abermals schnurstracks zurück, ich biege seiner netten Auskunft gemäß rechts ab und finde mich erneut ziemlich verloren inmitten einer großen Wiese vor. Nur dass dieses Mal auch ein Mann mit Metalldetektor einsam über die Felder streift. Ich bin beruhigt, bin wohl doch nicht der einzige hier, der auf der Suche nach irgendetwas ist.

Die Zeit verstreicht, die Verzweiflung wächst. Sollte mir Yannick einen Bären aufgebunden haben? In der Ferne kann ich den Europaturm und die Sozialbauklötze des Frankfurter Bergs erspähen, und – Gott sei Dank, einen Spaziergänger! Doch Moment mal, ist das nicht… der einsame Mann ohne Hund!
Als ich ihn erreiche, muss er laut lachen. “Sagen Sie jetzt nicht, Sie seien immer noch auf der Suche?”. Ich sage nichts, er versteht. “Dann führe ich Sie jetzt persönlich hin!”. Ich bin dankbar, steige vom Fahrrad und trotte fortan treudoof an seiner Seite. Er erzählt mir vom Krieg, wie viel Munitionsreste er bei seinen Spaziergängen selbst schon in den Feldern entdeckt habe. Und vom alten Sender, an den er sich noch erinnern kann….
Meine Freude ist groß, als ich endlich vor einem alten Wachhäuschen stehe, das Graffiti-Künstlern als Leinwand diente.

“Und sehen Sie den Beton-Klotz da?” Klar tue ich das. “Das sind Fundamente der Flugabwehr der Wehrmacht. Bis heute hat sich niemand dazu berufen gefühlt, sie zu entfernen”. Ich erkunde neugierig die Relikte aus düsterer Zeit. Unheimliche Zeitzeugen. Wenig später dann haben wir unser Ziel erreicht: Die Überreste des alten Senders Heiligenstock.

Gut zu erkennen sind tatsächlich heute noch die vier Betonsockel, auf dem einst die Stahlstreben des Turmes ruhten. Auch die Verankerungen, an denen der Sendeturm einst abgespannt war, haben die Zeiten überdauert. Das verfallene ehemalige Technikgebäude aber zieht mich zweifelsfrei am meisten in seinen Bann. Nur noch Ruine, Überreste eines Lagerfeuers vor dem Eingang. Irgendwie unheimlich.
Auch hier haben Graffiti-Künstler die alten Mauern als Leinwand genutzt, zaubern diesem abgelegenen Ort ein ganz besonderes Flair. Ich mache ein paar Fotos und lächele.Ich kann mir gut vorstellen, wie einzigartig es sich anfühlen muss, von hier aus einsam den Sonnenuntergang zu genießen.
Klar, ich hätte diesen freien Nachmittag auch wie so oft mit Buch und Cappuccino im Café verbringen können. Doch wäre ich vom Café-Besuch hinterher gleichermaßen fasziniert gewesen? Hätte ich anschließend das tolle Gefühl verspürt, nach langer Suche endlich etwas gefunden zu haben?




Dieser Ort ist ein ganz besonderer, den ich ohne Yannick wohl niemals entdeckt hätte. Und dafür sag’ ich “Danke!”, genau wie dem Spaziergänger – der zwar keinen Hund mehr hatte, dafür aber jede Menge spannendes zu erzählen. Die schönsten Orte jedenfalls, das sind doch die, die Emotionen wecken. Stumme Zeitzeugen, die nicht nur kurzzeitige Bedürfnisse befriedigen (Durst! Hunger!)
Ob all die Leute, die als ihren Lieblingsort die Zeil angaben (WTF?!) ahnen, welch versteckte Überraschungen die Stadt sonst noch so bereithält? Die Eindrücke, die ich an diesem Tag im Herbst erhalten durfte, die hallen nach – so wie einst die Rundfunkwellen des alten Hörfunksenders…

Habt denn auch ihr einen Lieblingsort, den man nicht einmal bei Google Maps finden kann? Der rund um die Uhr für euch ganz kostenfrei geöffnet hat, euch immer wieder eine wohlige Gänsehaut beschert? Einen Ort, an dem ihr Einsamkeit sogar genießen könnt?
Dann scheut euch nicht, ihn mir zu verraten! Ich nämlich hab’ so richtig Lust darauf bekommen, das nächste Relikt aus alten Tagen zu entdecken….
Alle Jahre wieder:
Einen gesamten Frankfurter Sommer lang kommt man aus dem Feiern gar nicht mehr heraus. An jedem Wochenende zelebriert selbst der kleinste Feldweg sein eigenes Straßenfest. Berger Straßenfest, Schweizer Straßenfest, Koblenzer Straßenfest, Opernplatzfest, STOFFEL, Sommerwerft, Apfelwein-Festival, Gutleuttage, Mainfest und Bahnhofsviertelnacht seien hier nur als einige Beispiele genannt. Die Frage danach, ob diese Stadt eigentlich jemals ausnüchtert, erscheint mir angesichts dieses Übermaßes jedenfalls gerechtfertigt.
Einen krönenden Abschluss findet dieser sommerliche Feier-Marathon dann alljährlich Ende August mit dem Museumsuferfest. Dieses fährt dann auch ein Programm auf, das sich gewaschen hat – und auf das es sich schon Wochen im Voraus mit akribischer Feinplanung vorzubereiten lohnt. Man will schließlich nichts verpassen!

Nicht nur, dass ein ganzes Wochenende lang zahlreiche der Museen mit nur einer einzelnen Eintrittskarte vergünstigt besucht werden können:
Auch zahlreiche Bühnen auf beiden Seiten des Mains locken mit buntem Programm. Zahlreiche Fress- und Suffbuden dürfen freilich ebenso wenig fehlen wie das große Feuerwerk zum Abschluss, welches schließlich einen fulminanten Schlussstrich unter die Saison Frankfurter Sommerfreuden zieht.
Auch ich wollte natürlich nichts verpassen und hab’ mich in die Menge gestürzt. Am Ende kam nicht nur das Feuerwerk, sondern gleichsam alles anders – zurück bleibt ein durchwachsenes Fazit…
Diese WhatsApp-Nachricht eines Kumpels ist auch für mich Befehl zum Aufbruch zum diesjährigen “MUF”-Besuch. Es ist früher Samstagabend, und nach einer ganz wunderbaren Auszeit in Kroatien bin ich noch nicht lange wieder zurück in Frankfurt, hab’ mich die letzten Tage allerdings erst einmal lediglich ausgiebig meinem Bett, meinen Schallplatten und meinen neuen Schwarzweißabzügen gewidmet. Nun aber, da strotze ich vor Energie – und Vorfreude auf das größte der Frankfurter Sommerfeste.
Ich schwinge mich also aufs Fahrrad, lasse mich beschwingt vom Nordend hinab gen Main rollen. Allein, dass ich – kaum den Frankensteiner Platz erreicht – weit und breit keinen freien Parkplatz für mein Velo finden lassen kann, hätte mir im Nachhinein schon Omen genug sein müssen. So aber bin ich erstmal genervt, bis ich dann irgendwann doch irgendwo in einer Sachsenhausen Seitenstraße ein einladendes Straßenschild finde, an das ich mein Fahrrad kette.
Ein Blick aufs Handy: Immer noch keine Standortmeldung meines Kumpels. Macht ja nix, flaniere ich schon mal langsam Richtung Holbeinsteg und schau’ mir unterwegs das rege Treiben an. Dieses besteht zunächst aus essenden wie trinkenden Menschen, die an den zahlreichen Buden entlang des Mainkais für mächtig Umsatz sorgen. Hier wie dort erblicke ich auch kleine Stände diverser Frankfurter Geschäfte, Kunsthandwerk, Klamotten. Warum ich ausgerechnet jetzt dort irgendetwas kaufen sollte, erschließt sich mir nicht ganz. So auch, warum ich ausgerechnet jetzt eines der Museen am Museumsufer besuchen sollte – kann ich schließlich auch das ganze Jahr über, dann sogar mit Bewegungsfreiheit.

Ich schieb’ mich also weiter gen Osten, die laute Musik der Bühnen unter mir am Main verwebt sich zu einem einzigen basslastigen Lärmteppich in meinen Ohren und zehrt an meinen Nerven. Immer noch kein Standort.
“Hey, bist du Raucher?” – ein junger Kerl am Promo-Stand eines Zigarolle-Herstellers lenkt meine Aufmerksamkeit vom Trubel ab.
“Klar!”, sag’ ich und trete näher. Er bietet mir ‘ne Vanilla-Fluppe an, ich nehm dankend an und einen ersten Zug. Rauchen fetzt! Doch klar, der junge Herr hier handelt nicht aus Nächstenliebe. Seine Mission heißt: Geschäfte machen, Umsatz ist sein Auftrag. Und das versucht er dann auch, in Form eines “unschlagbaren Angebots”: Wenn ich ‘ne Schachtel kaufe, erhalte ich gleich zehn einzeln verpackte Zigarillos obendrein, ach was, ZWANZIG, weil ich es bin – und damit nicht genug: Auch gleich sechs Feuerzeuge soll ich nach dem Schachtelkauf mein Eigen nennen dürfen. Ich lache, lehne dankend ab. Nichts gegen Zigarillos, aber ich möchte ungern gleich ‘ne ganze Tüte voll mit Produktproben und Feuerzeugen spazieren tragen.
Wesentlich besser gefällt mir da schon das große Glücksrad am car2go-Stand, an dem auch ich mal drehen darf. Wenn schon kein Glück in der Liebe, dann Glück im Spiel: Ich staube fünfzehn freie Fahrtminuten ab. Dies sollte dann aber auch der letzte freudige Moment dieses Abends auf dem MUF bleiben, denn: Immer noch keine Standortmeldung vom Kumpel, auch meine Nachrichten scheinen ihn nicht zu erreichen. Naiv beschließe ich, ihn schon irgendwie ausfindig zu machen – und steige die Treppe hinab ins Gedränge direkt am Mainufer.
Nach nur wenigen Metern stecke ich in der Menge fest; ein Weiterkommen scheint unmöglich. Die “R:Y:M”-Bühne unerreichbar. Fremde Schultern prallen gegen meine, eine junge Frau rammt mir unsanft die Griffe ihres Kinderwagens in die gebrochenen Rippen. Mit Kleinkind zum Museumsuferfest – wohl auch ‘ne recht pfiffige Variante, sich des ungeliebten Nachwuchs zu entledigen. Ich selbst sehe mich derweil meiner Nerven entledigt, nein, so wird das nix. Ich mache in einem waghalsigen Move kehrt und steige wieder auf den Mainkai herauf. Lasse meinen Kumpel wissen, dass das wohl nix mehr wird heute. Die Nachricht kann nicht zugestellt werden.

Wohl aber die Nachricht, die mich von einem anderen Freund erreicht: Er sei an der Bühne vor dem MainCafé, ob man sich denn treffen wolle. “Ich eile!”, antworte ich, bahne mir meinen Weg durch die Trinkenden und Fressenden.
Noch einmal kurz durchatmen, noch einmal herunter ans Mainufer. Doch auch hier das selbe Bild, hier meinen Freund zu finden, scheint ein unmögliches Unterfangen.
Auch meine Nachrichten an ihn versacken im digitalen Nirvana der Netzüberlastung.
Überlastet sind nun auch endgültig meine Nerven, ich beschließe, diesen Abend nach nunmehr drei Stunden im Gedränge einfach abzuhaken und mit einem kalten Apfelwein ausklingen zu lassen. Ich befreie mein Fahrrad vom Straßenschild und flüchte schleunigst vor all dem Trubel. Erreiche das Kiosk am Frankensteiner Platz, erstehe eine eisgekühlte Dose Apfelwein. Herrlich, ist das ruhig hier!
Ich beziehe Stellung am Tisch vor dem Eingang. Der erste Schluck Apfelwein des Tages entspannt mein Gemüt, ich zücke meine Zeitschrift und lese. Zumindest, bis ich von einem Herren in Jeanshemd unterbrochen werde. “Darf ich mich dazustellen?” fragt er, “Klar!” sag’ ich. Er hebt sein Bier, wir stoßen an, ich widme mich wieder meiner Lektüre. Bis ich abermals unterbrochen werde.
“Du liest gern”, stellt der Mann im Jeanshemd fest, “das find’ ich gut.”
Tja, so schnell ist man halt im Gespräch in Frankfurt. Wir beginnen, uns über das Lesen zu unterhalten, über Frankfurt, das MUF, den großen Andrang.
Auch er war natürlich da, erzählt er, habe aber irgendwo in der Menge Frau samt Kinder verloren. Aber das, gesteht er zu meiner allgemeinen Erheiterung, sei ihm ganz recht: Endlich habe er mal Zeit die Zeit dazu, sich einfach ungestört “gepflegt einen reinzuschädeln”. Er entschuldigt sich kurz, kehrt mit gleich zwei Bier zurück, bietet mir eines an.
Wir sinnieren gerade über Hesses “Glasperlenspiel”, als zwei junge Damen sich zu uns gesellen. Eine von beiden spricht mich unvermittelt an.
“Ey, du bist doch der Typ, der immer durch die Koselstraße joggt – und auf dem Rückweg immer kurz vorm Kollaps scheint!”
Verdammt. Ja, der bin dann wohl ich. Es hätte mir zwar mehr geschmeichelt, hätte sich mal als “den Typen mit dem coolen Blog” erkannt, dennoch freue ich mich über diese unverhoffte Begegnung mit einer Nachbarin. Hier, am mittlerweile späten Samstagabend, an einer Trinkhalle in Sachsenhausen.
Wir schwadronieren ein wenig, die beiden Damen verabschieden sich. Zurück bleiben der Mann im Jeanshemd, der sich mittlerweile als Manfred aus Oberrad vorgestellt hat. Außer unserer Vorliebe für Hermann Hesse teilen wir beide viele Erinnerungen an die Stadt Dortmund, in denen wir ausgiebig schwelgen.
Dabei scheinen wir einen überaus vertrauensvollen Eindruck zu machen. Zunächst strauchelt nämlich ein offensichtlich recht betüddelter junger Mann auf uns zu und bittet uns, kurz auf seine Zigarette aufzupassen. Kein Problem doch, machen wir! Der junge Mann ward nicht mehr gesehen.
Kaum ist seine Kippe verglommen, werden abermals unsere wachsamen Augen gefragt. Ein nochmals betüddelterer junger Mann tritt neben uns, bittet uns, doch bitte kurz auf den Kanzlerkandidaten der SPD aufzupassen. Also nicht Martin Schulz in persona, vielmehr auf sein übergroßes Konterfei, das auf einem Wahlplakat prangt. Ich grinse in mich hinein – dass die Leute im Suff auch immer sinnlose Dinge stehlen müssen! Manfred, ich und ein breit lächelnder Martin Schulz säumen nun also den Aluminiumtisch, aus der Ferne ist die laute Musik des „MUF“ zu hören. Eigenartige Zusammenkunft, aber unterhaltsam. „Sorry, hatte keinen Empfang“ – eine erste Antwort meines Kumpels erreicht mich auf dem Telefon. Sei’s drum, ist jetzt auch zu spät.
Martin Schulz wird wieder abgeholt, der glückliche Dieb bedankt sich übermütig für unsere Dienste. Der Platz des Kanzlerkandidaten wird prompt von einem jungen Pärchen eingenommen, das sich in unseren netten Plausch einklinkt und dann doch noch dafür sorgt, dass ich an diesem Abend ein wenig nette Unterhaltung gefunden habe. Ein Familienvater ohne Familie, ein schlafloses Liebespaar und ich: Diese Runde erscheint mir ganz plötzlich als die viel bessere Alternative zum Museumsuferfest.
Irgendwann zieht es aber auch mich einmal gen Bettchen. Noch während des Heimwegs beschließe ich, das „MUF“ am morgigen Sonntag erst einmal links liegen zu lassen. Nur das Feuerwerk am Abend, das mag ich mir anschauen – das war in den vergangenen Jahren nämlich wirklich immer schön.

Und als ich dann Sonntag mit ein paar Freunden (die ich tatsächlich auf Anhieb finden konnte!) in den Frankfurter Abendhimmel schaue und die bunten Raketen aufsteigen sehe, kann ich nur bestätigen: Jawoll, hat sich auch in diesem Jahr wieder einmal gelohnt. Auf den Rest allerdings, auf all das Gedränge und Geschriebe, das Rumstehen, das Verzehren astronomisch teures Fast Foods, das Konsumieren der ach-so-fancy-sommerlichen Kaltgetränke, auf all das hätt’ ich auch verzichten können.
Seit ich in Frankfurt lebe, habe ich Jahr für Jahr das „MUF“ besucht. Und anfangs, da fand’ ich’s auch immer so richtig geil, laute Musik unter freiem Himmel, Remmidemmi, Apfelwein. Doch mittlerweile, da fühl’ ich mich irgendwie zu alt für den Scheiß, empfinde vor allem das große Gedränge als anstrengend. Komisch, hatte mich früher irgendwie nie derart gestört.
Wobei: Früher, also ganz früher, fand ich’s auch ziemlich geil, in überhitzten Kerbzelten Asbach-Cola aus Gießkannen zu trinken.
 Klar:
Klar:
Fressen, Saufen und im Gedränge tanzen, auch das mag irgendwo Kulktur sein. Nur allerdings wohl nicht mehr meine. Allein das Feuerwerk empfand ich nach wie vor als sehenswert.
Mein eigentliches Highlight dieses Wochenendes, das war jedoch die so vollkommen absurde nächtliche Zusammenkunft an der Trinkhalle, die man mit all ihrem Unterhaltungswert
so niemals hätte planen können.
In einem meiner Lieder hatte ich Frankfurt jüngst als “Diva, die nie schläft” bezeichnet. Dies ist ganz sicher richtig, aber dennoch:
Es gibt da einen einzigen Moment in der Woche, eine einzige Stunde, in dem die Stadt so jungfräulich und verlassen wie sonst nie. In der eine seltsame Ruhe herrscht, die Straßen leergefegt. Eine Stunde, in der selbst Frankfurt ein wenig unschuldig wirkt.
Es ist die Stunde am Sonntagmorgen, 06.30 Uhr.
Der durchschnittliche Frankfurter befindet sich noch irgendwo im Reich der Träume. Endlich einmal ausschlafen. Oder aber, er ist gerade erst ins Bett gefallen, ob ins Eigene oder das einer nächtlichen Bekanntschaft. Schläft seinen Rausch aus nach einer glückseligen, langen Nacht der wilden Feierei.
Ich indes wäre auch lieber im Bett und würde selig schlummern, aber es hilft ja nichts: Dienst ist Dienst, Frühschicht ist Frühschicht – und ein ansehnlicher Sonntagszuschlag (steuerfrei, versteht sich!) entschädigt mich dafür, dass mich mein zur Unzeit klingelnder Wecker aus meinen Träumen gerissen hat.
Und außerdem, da darf ich diesen Moment erleben, der den Allermeisten verwehrt bleibt:
Kalte Dusche, notdürftig die Frisur herrichten, zwei schnelle Tassen Kaffee. Rucksack schultern, ein letzter Blick in den Spiegel. Auf geht’s, die Pflicht ruft.
Ich trete aus dem Haus, hey Frankfurt, auch schon wach?

Am Matthias Beltz-Platz zeugen jede Menge leere Bier- und Weinflaschen von den Geschehnissen der letzten Nacht. Einige davon zertrümmert, und auch der Mülleimer schaut nicht mehr ganz gesund aus: Schwarz und deformiert, kaltes Plastik auf dem Asphalt. Hat wohl wieder mal jemand angezündet.
Die Stadt, sie wirkt verwundet, irgendwie. Gleichsam aber endlich einmal in Ruhe gelassen, von all den Menschen, von all der Hektik, die sie ansonsten permanent in ihren Straßen versprühen. Ich steige aufs Rad, auf dem Baum über dem Fahrradständer höre ich Vögel singen.
 Rolle die Friedberger Straße hinab, werfe einen Blick nach hinten: Kein Auto weit und breit, der Blick nach vorn: Kein Auto bis zum Horizont. Ein ganz und gar surrealer Anblick, weiß man, welch Blechlawine hier ansonsten das Straßenbild bestimmt. Die Ampel indes, die wechselt ungeachtet dieser Tatsache dennoch ganz pflichtgemäß munter zwischen Grün, Gelb und Rot umher.
Rolle die Friedberger Straße hinab, werfe einen Blick nach hinten: Kein Auto weit und breit, der Blick nach vorn: Kein Auto bis zum Horizont. Ein ganz und gar surrealer Anblick, weiß man, welch Blechlawine hier ansonsten das Straßenbild bestimmt. Die Ampel indes, die wechselt ungeachtet dieser Tatsache dennoch ganz pflichtgemäß munter zwischen Grün, Gelb und Rot umher.
Die Straßenbahnhaltestelle zieht vorbei, die Anzeige verrät:
Nächste Straßenbahn in 22 Minuten. Was ansonsten sofortige Empörung, zahlreiche Taxi-Bestellungen und Beschwerde-Mails an die VGF nach sich ziehen würde, interessiert in dieser Stunde jedoch keine Sau.
Auch mich nicht, bin ja schließlich mit dem Fahrrad unterwegs. Ich erreiche das Hessendenkmal, biege rechts ab. Auf den Tischen des Phuket Thai-Imbiss kauern diejenigen, die es nicht mehr nach Hause gepackt haben. Wo ansonsten dampfende Teller von Udon-Suppe und Hühnchen-Curry stehen, präsentieren sich grüne Flaschen eines weithin bekannten Kräuterlikörs aus Wolfenbüttel. Ehe ich mir die Frage stellen kann, wo Wolfenbüttel eigentlich liegt, passiere ich die Große Friedberger Straße.
Leere Flaschen treiben im Brunnen, zeugen von Freuden und Exzessen der letzten Nacht. Einige sind zerschlagen – ja, auch Aggressionen und Gewalt hat es sicher wieder gegeben in der letzten Nacht. Das übliche Gehabe junger Männer, zu viel Frust, zu viel Energie.

Die Morgensonne streichelt mein Gesicht wie auch das Pflaster der Zeil. In den Eingängen der Geschäfte liegen reglose Gestalten auf Pappkartons. Die Geschäfte, die werden heute einmal nicht öffnen, gönnen sich einen einzigen Tag lang eine Verschnaufpause. Amazon wird’s freuen. Und auch die schlafenden Gestalten, die ihre Eingänge säumen, die scheinen endlich ihren Frieden gefunden zu haben. Wenn auch nur für kurze Zeit.
Cafés und Lokale sind noch verrammelt, Tische und Stühle brav zusammengeklappt und angekettet. Nicht mehr lange wird es dauern, und die beflissentlichen Kellner werden sie wieder aufstellen, damit die Frühaufsteher zum Sonntagsbrunch ausströmen können. “Entspannt in den Sonntag starten”, wie sie so schön zu sagen pflegen. An Entspannung ist bei mir derweil nicht zu denken, ein langer Arbeitstag liegt vor mir. Ich schalte einen Gang hinunter, die Talfahrt ist beendet.
Hallo Hauptwache, ich biege halb links ab, erreiche das Bahnhofsviertel. Passiere das “AMP”, wo wenige Stunden zuvor ganz sicher noch lauter Techno die Stille der Nacht zerrissen hat. Biege ein in die Münchner Straße. In einem Hauseingang entdecke ich Leben in Form eines eng umschlungenen Paares. Leidenschaftliche Küsse, wenn auch beide nicht mehr ganz standfest auf den Beinen scheinen.
Wenige Meter weiter, ich spähe im Vorbeifahren durch die geöffnete Tür einer Kneipe. Am Tresen sitzt jemand, offensichtlich Inhaber, ‘ne Menge Scheine in der Hand. Er zählt die Einnahmen der letzten Nacht – ob es sich wohl gelohnt hat für ihn? Bald wird auch er im Bett liegen, vielleicht wird auch er endlich noch ein Bier trinken können nach all dem Trubel der letzten Nacht, all seinen Gästen auf der Suche nach dem Irgendwas. Im Zweifel dem Vergessen.
Ich weiche Erbrochenem auf der Straße aus. Auch dies ein seltener Anblick, ich weiß genau: Es dauert nicht mehr lange, bis die fleißigen Jungs der FES mit Dampfreinigern dafür sorgen werden, dass selbst die Straßen des Bahnhofsviertels wieder aussehen werden wie geleckt. So, als wäre hier nie etwas passiert, als habe nie etwas stattgefunden auf diesem “heißen Pflaster”.
Ich zucke zusammen, als ich – noch ein wenig schlaftrunken – in eine Gruppe bärtiger Männer fahre, bekleidet im strahlenden Gewand samt Takke, der traditionellen Kopfbedeckung für das muslimische Gebet. Sie sind auf dem Weg zum Frühgebet in die nahe gelegene Moschee.
“Was muss das für ein Glaube sein, der einen bereits zu dieser Unzeit zum Gebet treibt”, denk’ ich mir. Mein Glaube, der gilt in diesem Moment allerdings allein dem pünktlichen Dienstantritt sowie dem damit verbundenen pünktlichen monatlichen Gehaltseingang. Living for capitalism.
Mein Ziel ist erreicht, die Hallen des Hauptbahnhofs erstrecken sich vor meinen Augen und erbieten Ehrfurcht. Ich schließe mein Fahrrad an, eile hinab in die B-Ebene. Die Treppen sind gesäumt von den ärmsten Existenzen unserer Stadt. Ja, selbst die Junkies haben einen kurzen Moment lang Schlaf und Ruhe gefunden. Es wird nicht mehr lange dauern, und ihre Sucht wird sie aufwecken, wird sie dazu bringen, all ihre restliche Kraft aufzuwenden, um an den nächsten Stein, den nächsten Schuss zu bekommen.

Der Moment, in dem selbst Junkies schlafen. Der Moment zwischen dem letzten Drink einer durchgefeierten Nacht und den ersten Anzeichen sonntäglicher Aktivität, den ersten Radfahrern, die mit verschlafenen Augen ihre Touren beginnen,den ersten Joggern, die die Gunst der frühen Stunde nutzen möchten – dieser Moment ist nur von kurzer Dauer. Dieser Moment ist wohl der einzige, in der die Stadt dem Menschen ganz unschuldig zu Füßen liegt. Verletzt, erschöpft und ruhig.
Es ist eine ganz eigene Art der Romantik. Doch sie erleben zu dürfen macht es allemal wett, überhaupt wach sein zu müssen in dieser Stunde. Sonntagmorgens, Sechs Uhr Dreißig.
Erstmals bin ich wieder mittendrin im Leben.
“Meine Damen und Herren auf Gleis 9, der InterCityExpress nach Berlin verspätet sich aufgrund eines Böschungsbrandes um voraussichtlich 15 Minuten…”
Trolleys schleifen auf dem Bahnsteigpflaster, Reisende starren ungeduldig auf die Uhr. Der Hauptbahnhof, wohl tatsächlich der einzige Ort, an dem gerade alles ist wie immer.
Wenn ich heute Abend meinen Dienst beendet haben werde und nach Hause radeln werde, dann wird der Kaisersack wieder von den üblichen Gestalten bevölkert, werden die Lokale auf der Kaiserstraße wieder gefüllt sein. Die Menschen werden sich sich dann doch irgendwie aus dem Bett gequält, den Sonntag verbracht haben. In Museum oder Kino, auf Fahrrad oder Sofa. Und abends dann noch zum Essen oder Trinken treffen, der Ausklang eines Wochenendes.
Sie alle werden morgen wieder ihrem Alltag nachgehen. Am Montagmorgen, wenn auch die Friedberger Landstraße wieder von Autos verstopft, die Zeil dem Shopping-Rausch erlegen sein wird.

Es ist Samstag. Während sich der gemeine Frankfurter ab spätestens 14 Uhr mittels Weinschorle an Kleinmarkthalle oder Rauscher auf dem Wochenmarkt bereits wieder zielsicher an den Pegel vom Vorabend heran trinkt, schiebe ich Dienst.
Ich bin seit 13 Stunden unterwegs, als ich am frühen Abend endlich meine Wohnung betrete. Meine Einkäufe verstaue, ein bisschen Erwachsenen-Zeugs erledige (Rechnungen begleichen, Schriftwechsel mit der Krankenkasse- ja, auch das gehört eben dazu…), schlussendlich heilfroh im Bett lande.
Die preisexklusive Wohnlage im “lebhaften und urbanen Nordend” zollt dank Friedberger Landstraße und samstäglich belegtem Matthias Beltz-Platz eben ihren Tribut. Ursprünglich, da wollte ich ja mit einer Bekannten feiern gehen. Angesichts meiner Verfassung – es ist mittlerweile kurz vor Mitternacht, ich bin seit fünf Uhr heute Morgen auf den Beinen – erscheint es mir jedoch als keine gute Idee, noch irgendwo Eintritt zu bezahlen, um wenig später auf der Tanzfläche einzuschlafen.
Ein Kumpel schreibt, er befinde sich in einer stadtbekannten Musikkneipe in Alt-Sachsenhausen. “Puh”, denk ich mir, “es ist Samstagabend, ich habe morgen frei – wann kommt das schon mal vor?” – ein Apfelwein, der ist sicher noch drin.
Ich eile ins Bad, rette, was zu retten ist. Stürme das Treppenhaus hinunter, eile zur Straßenbahnhaltestelle.

Man darf ja auch mal Glück haben: Die nächste Achtzehn kommt in drei Minuten. Reicht gerade noch zum Geldholen.
Ich eile zur Sparkasse, stecke meine Karte in den Geldautomaten, wähle routiniert “anderen Betrag auswählen”. Will den für einen Samstagabend obligatorischen Fuffi abheben, tippe auf der Tastatur herum – huch, ja, eine Null zuviel, herzlichen Glückwunsch:
Ich halte einen 500-Euro-Schein in der Hand. Scheiße. Sollten die nicht eigentlich längst abgeschafft sein? Damit durch Alt-Sachsenhausen zu schlendern, das erscheint mir als keine gute Idee.
Also: Gleich herübergeeilt zum gegenüberliegenden Einzahlungsautomaten.
“Für Kunden fremder Sparkassen ist eine Bargeldeinzahlung leider nicht möglich”. Fuck, wollte ich nicht bereits vor sieben Jahren meine Hausbank wechseln?
Aber: Kein Stress, keine Panik. Ich bestaune kurz die enorme Größe des 500ers, die Pizzeria ums Eck hat noch geöffnet. “Können Sie mir eben wechseln?”, ich zücke meinen lila Schein, man zeigt mir den Vogel. “Sie spinnen wohl!”. Na, schönen Dank auch.
Also: Wieder ab nach Hause, den “Lilanen” ins Kopfkissen einnähen.
Als ich den lila Riesen in der Hand halte (der ist wirklich großformatig!), da komme ich kurz in Versuchung.

Zusammenrollen, ‘ne Linie Koks draus ziehen – das hätte doch Stil!
Blöderweise habe ich aber weder Drogen noch Drogenerfahrung, und alleine zu Hause weißes Pulver ziehen, das erscheint dann selbst mir als ein wenig unangebracht. Auf der Toilette des Gibson müsste das schon sein – blöderweise habe ich allerdings weder Lust auf das dortige Bänker-Stelldichein noch Bargeld für den Eintritt. Oder akzeptieren die auch Kreditkarte? Scheiß’ drauf, Koksen ist eh nicht meins. Auch wenn es bekanntlich wach machen soll – hätte ich nötig gerade. Wo ich aber gerade unverhofft wieder zu Hause bin, tut’s aber noch ein schneller Espresso.
Die Straßenbahn ist zwischenzeitlich längst weg, ich besteige mein Fahrrad, auf ein Neues zur Sparkasse. Hebe ich dieses Mal eben ganz gewissenhaft 20 Euro ab. “Von Ihrem Konto sind derzeit leider keine Verfügungen möglich.
Scheiße, das Tageslimit von 500 Euro an Bargeld ist erreicht, ich bin mittellos. Und es ist kurz nach zwölf. Kein Geld für mich also bis Montag.
Immerhin, mein Fahrrad fährt ganz kostenlos, ich rolle hinab gen Sachsenhausen. Unterwegs rufe ich meinen Kumpel an, der wird mir doch sicher was leihen können. “Der Teilnehmer ist momentan…” – statt Kumpel in Musikkneipe meldet sich die Mailbox. Ja, leckt mich doch alle am Arsch.
Setz’ ich halt mich erstmal in die Kneipe nebenan. Drahtesel angeschlossen, trete ein, nehme Platz an der Theke. Hab’ zwar kein Geld mit, dafür aber die “Extra News”, die BILD des kleinen Mannes (und das will was heißen!), die ich aus einem Briefkasten ziehen konnte. Werde darauf angesprochen von meiner Sitznachbarin, nette Frau, mein Alter.
Es entwickelt sich ein Gespräch, schlussendlich berichtet sie mir davon, dass es neulich ziemlich übel gerochen habe in ihrer Wohnung in Oberrad. Ob es denn an den sieben Kräutern gelegen habe, frag’ ich sie im Scherz – sonst fällt mir ja nicht viel ein zum äußeren Stadtteil an der Grenze Offenbachs. “Nee”, ist ihre Antwort. “Als ich vom Urlaub kam, da musste ich feststellen, dass ich vorher vergessen hatte, abzuspülen. Und meine Pisse, die hatte nach all den Tagen echt zu stinken angefangen”.
Ich schaue verstört, too much Information. Lenke das Thema schnell auf mich, schildere den bisherigen Verlauf meines unschönen Samstagabends.
Bin dankbar, als sie mir aus Mitleid – ich habe ja WIRKLICH kein Geld dabei – einen Apfelwein spendiert. Stoße mit ihr an, lenke das Gespräch auf interessante Inhalte. Aha, aha, Quarterlife-Crisis- oder schon “Midlife”? Man weiß es nicht genau, philosophiert. Und das in Alt-Sachsenhausen. Dass ich das noch erleben darf!
Mein Kumpel meldet sich, er hat offensichtlich wieder Empfang. Ich verabschiede mich höflich von meiner neuen Bekanntschaft aus dem fernen Oberrad, eile herüber ins Musiklokal. Immer noch stocknüchtern, ein Apfelwein allein war schließlich noch nie Garant für die eine “Nacht des Lebens”:
Hallo auch Kumpel, ohjeh, die haben’s aber auch alle hinter sich. Schon eigenartig, hier zu sein – stocknüchtern, während der ganze Rest vermutlich bereits rauschbedingt so ‘nen “richtig geilen Abend” hat. Der schlussendlich darin besteht, zu trinken und die immergleichen Lieder mitzusingen. Mag spaßig sein, jedoch nicht nach einem kleinen Apfelwein. Verdammt, ich erahne erste Defizite angesichts meines Alkoholpegels.
Ich klage mein Leid, mein Kumpel (Du bist der Beste!) erbarmt sich, mir einen Apfelwein auszugeben. Ja denn, zum Wohl, ich beobachte. Der Rest schwankt, ich stehe. Der Rest singt, ich schweige. Nee, das ist nicht mein Abend. Hätte gleich im Bett liegen bleiben sollen.
Verabschiede mich höflich wie nüchtern, besteige den Nachtbus. Bin froh, als ich mich im Flur meines Wohnhauses befinde. Zu meiner Irritation befindet sich bereits eine ganze Horde vor dem Aufzug im Treppenhaus: Um genau zu sein eine Horde offensichtlich englischsprachiger Touristen, die den rechten Arm zum Himmel strecken, ein akzentuiertes “Heil Hitler!” brüllen.
“Oh, just kidding, German brother”, sagen sie zu mir, peinlich erwischt. Ich teile mit ihr den engen Raum des Aufzuges, Baujahr 1962 – made in good old Germany.
Bin unendlich froh, als ich meine Wohnungstür aufschließe. Meinen Laptop aufklappe, um mir meinen Frust von der Seele zu schreiben. Und morgen nüchtern zu sein – um etwas “zu haben vom Sonntag”, wie man so schön sagt in meinem Alter.
Habt auch immer was, ihr Lieben – und wenn es nur die tragische Komik ist.
Was ist das eigentlich für ein “Ding”, das da alle machen? Nicht im Kollektiv, nein, jeder ganz für sich? Im Lauten wie im Leisen, jedenfalls ganz sicher jeweils absolut individuell? So individuell sogar, dass dieses “Ding” mitunter oftmals als “das eigene Ding” bezeichnet wird?
Fast fühle ich mich ein wenig schlecht, euch nun mit dieser alten Kamelle anzukommen: “Mach’ dein eigenes Ding”, “Beib’ du selbst” – ziemlich ausgelutscht, diese Phrasen. Totgeschrieben ohnehin, ich will mir gar nicht vorstellen, wie viele Posts, Artikel, Aufsätze, Bücher schon über jenes mysteriöse “eigene Ding” verfasst wurden. Wohl jeder Bravo-Leser weiß um diese Binsenweisheit.
Und wie sieht es in der Praxis aus, beschließt man, fortan sein “eigenes Ding zu machen” ? Bedeutet es völlige Rücksichtslosigkeit in beruflichen wie privaten Belangen, ein Loslösen von jeglichen Konformitäten – oder bleibt es am Ende doch nur hohle Phrase?
Ich hab’ einfach mal ein paar Leute gefragt, ob sie denn ihr eigenes Ding machten. Wenig überraschend, dass die prompte Antwort stets lautete:
“Natürlich mach’ ich mein eigenes Ding!”
Eine anders lautende Antwort habe ich derweil nie bekommen. Klar, wer behauptet schon von sich, fremdgesteuerter Mitläufer zu sein, ein Mensch ohne Meinung, gar ohne Ziele?
Ich fragte weiter nach. Was die Leute denn konkret darunter verstehen, “ihr eigenes Ding zu machen”. Nun blickte ich zumeist in ratlose Gesichter, statt eine schnelle Antwort zu erhalten. Da müsse man noch mal genau überlegen, ja, das sei gar nicht so einfach zu definieren, jenes eigene Ding.
So einig sich alle darin waren, ihr Ding zu machen – so schwierig scheint die Frage nach einer Definition dieses Dinges zu sein, nach dessen Bedeutung, nach dessen Umsetzung.
Anlass genug für mich, mir ein paar Gedanken zu machen. Auch ich bin schließlich felsenfest davon überzeugt, mein Ding zu machen. Was ich allerdings konkret darunter verstehe, wie sich die Ausübung des Dinges konkret auf mein Leben auswirkt: Das fällt auch mir zunächst nur schwierig in Worte zu fassen.
Zeit, das zu ändern! Nehmt ihr Teil an meiner Ergründung des ominösen Dinges?

“Och nöö….”, werdet ihr euch nun denken. “Bitte nicht noch so ‘ne alte Kamelle”. Und ihr habt ja recht, kein Lebensmotto wird wohl inflationärer verwendet als “Carpe Diem” – Nutze den Tag. Zuhauf zu finden in Lebensratgebern, Poesiealben, in großen Lettern auf Facebook. Nein, besonders einfältig ist er wirklich nicht, dieser Auftrag, das Beste aus jedem Tag zu machen.
Dennoch:
Jeder sollte sich darüber bewusst sein, dass auch der eigene Tag nur 24 Stunden hat. 24 Stunden, die zur Verfügung stehen, um sie nach eigenem Belieben zu füllen. 24 Stunden, die genutzt werden wollen, um Ziele zu erreichen – oder an deren Erreichen zu arbeiten. Vorausgesetzt natürlich, man ist tatsächlich frei in der Entscheidung über die eigene Zeit – und nicht gerade in Gefangenschaft, noch minderjährig oder Komapatient.
Nun werden die ersten vielleicht widersprechen:
“Schön wär’s”, werden sie sagen – “Die meisten meiner Tage bestehen aus der Ausübung meines Jobs, Alltagspflichten wie Einkäufen, ein wenig Entspannung am Abend – und schlafen muss ich ja auch noch irgendwann. Wo bleibt da noch Zeit für freie Zeiteinteilung? Mein Chef zeigt mir ‘nen Vogel, wenn ich ihm erkläre, dass ich aufgrund akuter Unlust der Arbeit lieber fern bleibe!”.
Soweit, so richtig. Aber: Auch die eigenen Verpflichtungen wie der Job sind aus einer freien Entscheidung heraus getroffen. Und dienen einem ganz konkreten Ziel: Dem Erwerb eines Einkommens zur Absicherung der eigenen Existenz, als finanzielle Grundlage für alle weiteren Bereiche des Lebens, für den Luxus der eigenen vier Wände – oder zumindest ein Dach über den Kopf.
Und das ist doch schon mal ein ganz großes und hervorragendes Ziel, das ihr hier Tag für Tag erreicht, oder? Ihr habt euch aus freien Stücken dafür entschieden, täglich einige Stunden lang fremdbestimmt zu arbeiten. Dafür seid ihr die restlichen Stunden lang ein (finanziell) unabhängiger Mensch und könnt euer Leben auf ein solides Fundament bauen.
Auch ich quäle mich mitunter mitten in der Nacht um 2 aus dem Bett: Weil ich mich für einen Beruf entschieden habe, der dies gelegentlich erfordert. Der mir aber Freude bereitet, der mir mein Leben in Frankfurt finanziert. Und, wie ihr wisst: So ein Leben in Frankfurt, das ist leider kein immer günstiges Vergnügen.
Niemand würde euch davon abhalten, einfach nicht mehr am Arbeitsplatz zu erscheinen. Ihr müsstet nicht mal kündigen. Nur mit den Konsequenzen, mit denen müsstet ihr leben. Besteht nicht das gesamte freie Leben aus einem ständigen Abwägen von Entscheidungen und deren resultierender Konsequenzen?
Zurück zum Thema:
Jeder sollte sich darüber bewusst sein, dass jede einzelne Sekunde eines jeden einzelnen Tages aus freien Stücken heraus gestaltet und genutzt werden kann. Die Entscheidung, wie dies getan werden soll, obliegt alleine jedem einzelnen, freien Menschen.
Sich dieser Erkenntnis ganz bewusst zu sein ist die wichtigste Grundlage dafür, sein “eigenes Ding” zu machen.
Nach all der Küchentisch-Psychologie wird’s nun etwas praktischer: Ich mache mir Gedanken über Ziele. Alle reden über Ziele, jeder hat sie, manche sogar bereits erreicht. Ziele sind omnipräsent, sich mit ihnen zu beschäftigen ist unausweichlich.
Doch wieso eigentlich Ziele?
Ganz schön anstrengend also, sich permanent mit Zielen und deren Erreichen beschäftigen zu müssen. Zeitraubend ohnehin. Wieso nicht also gleich ganz bleiben lassen, sich entspannt und ganz ziellos zurücklehnen und die Welt einen schönen Ort sein lassen?
Ganz einfach: Weil der Mensch nicht zum “Sein” geschaffen ist.
Es liegt in der Natur des Menschen, niemals zufrieden mit dem Zustand der Beharrlichkeit zu sein. Jeder von uns strebt nach irgendetwas, ob bewusst oder unbewusst. Der Mensch erträgt keinen Stillstand, keine Langeweile. Das ist sein Fluch und Segen. Meint ihr, die Menschheit hätte jemals einen Fuß auf den Mond gesetzt, hätten sich alle gedacht: “Och ja, ganz nett heute, ich lass’ den Tag mal ‘nen schönen Tag sein und das Leben an mir vorüberziehen?”
Nein, das entspricht nicht unserer Natur. Und darum setzt sich jeder von uns ständig neue Ziele, im Großen wie im Kleinen:
Die Stunde joggen, die Einkäufe des Tages, die Ausbildung, das Studium, der Beruf, das eigene Kind, das gelesene Buch, das geschriebene Buch, die Urlaubsreise, die Verabredung mit einem guten Freund, der Frühjahrsputz, die Millionen auf dem Konto, das neue Auto, die Entspannung in der Sauna, das Bepflanzen eines Blumenbeets, die Traumwohnung, das Komponieren eines Liedes, das Erlernen eines Instrumentes oder einer Sprache, das Hören einer Schallplatte, das Leben in einer neuen Stadt, die Briefmarkensammlung, der Konzertbesuch:
All das sind Ziele, ganz Große und ganz Kleine. Schnell und leicht erreichbare – und welche, die nur langfristig und mit größerer Mühe zu erreichen sind. Ziele, die ein Jeder von uns hat. Ziele, die ganz unterschiedlich sind, und dennoch nur einer einzigen Sache dienen: Der Erfüllung von Bedürfnissen.
Es liegt in unserer Natur, dass wir nur zufrieden sind, wenn wir unsere Bedürfnisse durch das Erreichen unserer Ziele befriedigen. Und ebenso in unserer Natur liegt es wohl, dass wir uns – oft, bevor wir ein Ziel erreicht haben – schon ein nächstes Ziel setzen, um ein neues oder anderes Bedürfnis zu befriedigen. Und das allergrößte menschliche Bedürfnis, das ist das Bedürfnis nach dem “Mehr”, so denke ich.
Jeder von uns will immer mehr – mehr Sehen, mehr Erleben, mehr Gespräche, mehr Geld, mehr Geld ausgeben, mehr verkaufen, mehr kaufen, mehr Reisen, mehr Anerkennung, mehr Karriere, mehr Eindrücke, mehr Kultur, mehr sportliche Leistung, mehr Gesundheit, mehr Freude, mehr Technik, mehr Wissenschaft, mehr Information, mehr Freunde. Hauptsache mehr, dann geht’s uns gut.
Wunderbare Sache eigentlich, aber leider gar nicht so einfach, da durchzublicken. Es gilt also überlegen:
Wie möchte ich die nur 24 Stunden des Tages verbringen, um meine Ziele zu erreichen oder an ihrer Erfüllung zu arbeiten? Welches “Mehr” ist mir wichtig genug, ihm meine begrenzte Zeit zu widmen? Welches “Mehr” ist Zeitverschwendung, da es meine Bedürfnisse nicht befriedigt?
Ihr seht: Es ist überaus wichtig, die eigenen Ziele klar zu formulieren und im Blick zu haben. ALLES kann niemand erreichen, “von allem ein bisschen” erzeugt keine Glücksgefühle. Wichtig ist allein, was euch wichtig ist. Dem ihr alles Andere – auch die kurzfristigen Verlockungen – unterordnet. Und euch dabei stets darüber bewusst seid:
Jede Entscheidung FÜR etwas ist zeitgleich eine Entscheidung GEGEN alles Andere. Lässt sich nix dran machen, Naturgesetz, is’ halt so.
Und auch Zeit, die hat man nicht – man muss sich bewusst dafür entscheiden, sie sich zu NEHMEN.
Soweit also meine Gedanken über Zeit, Ziele und Entscheidungen. Wer sich allein auf die Erreichung seiner ganz eigenen Ziele fokussiert, Verlockungen trotzt, sich immer wieder ganz bewusst entscheidet: Der macht für mich “sein Ding”.
Jetzt muss ich mir nur noch überlegen, wie ich dieses “Ding” konkret in mein eigenes Leben übertragen kann. Oder mache ich es vielleicht bereits, mein eigenes Ding?
Ja, ich habe Ziele. Noch so einige, für die ein einzelnes Leben niemals ausreichen würde. Bleibe ich also erst einmal im Kleinen:
Ich weiß um die Dinge, die mich glücklich machen. Einen neuen Blog-Artikel zu veröffentlichen, beispielsweise. Eine Radtour ins Grüne, dabei ungeahnte schöne Flecken Erde entdecken. Ein Buch durchgelesen zu haben. Besonders zufrieden zu sein mit einem Bild, das ich vom Entwickeln abhole – und ein weiteres meiner Foto-Alben zu vollenden.
Niemand zwingt mich dazu, diese Dinge zu tun. Ich entscheide mich ganz bewusst dazu, Zeit und Energie in sie zu investieren. Und damit gegen alles andere. Klingt erstmal ziemlich simpel, doch Halt!
Die Tücken der Ablenkung
Was sich theoretisch erstmal easy anhört, ist dann doch mitunter nicht immer einfach konsequent umzusetzen. In diesem Moment, in dem ich diese Zeile schreibe, da erinnert mich der SPIEGEL ONLINE-Tab in meinem Browser daran, dass ich auch mal wieder das Weltgeschehen checken könnte. Auch der Facebook-Tab bereitet mir ein schlechtes Gewissen, ich hab’ nämlich schon wieder neun Benachrichtungen und zwei private Nachrichten, die gelesen und beantwortet werden wollen. Ach ja, E-Mails hab ich auch schon seit drei Stunden nicht gecheckt.
Doch – ich erinnere mich daran, dass es mein Ziel ist, diesen Beitrag zu schreiben. Und damit, so denke ich, mache ich mein kleines, eigenes Ding. Zumindest in diesem Moment. Doch die Tücken der Ablenkung, sie lauern überall und ständig.
Eine Nummer größer: Wenn ich eigentlich ein Buch lesen möchte, die Kumpels aber zum spontanen Umtrunk laden – dann sage ich ab, setze mich alleine ins Café und lese. Oder stoße eben später zum heiteren Umtrunk, weil ich erst noch lesen möchte.
Ja, und öfters, da geh’ ich auch einfach mal nach Hause, weil ich unbedingt noch einen Beitrag schreiben oder Fotos einkleben möchte – statt den dritten Apfelwein zu bestellen. Das erzeugt zwar öfters mal Unverständnis (“Kannste doch auch morgen noch machen, jetzt bleib’ schon hier, ist ja gerade so lustig!”) – mach’ ich dann aber nicht und gehe allen Widerreden zum Trotz nach Hause.
Auch damit mach’ ich mein Ding.
Ist das nun egoistisch?
Während ich diese Zeilen schreibe, merke ich, dass sich das zunächst mal ziemlich egoistisch anhört. Ein Leben, einzig und allein ausgerichtet auf die Erfüllung der eigenen Ziele? Und was ist eigentlich mit den anderen? Bin ich nun rücksichtsloser Egoist?
Ich denke, nein. Das beharrliche Festhalten an eigenen Zielen und deren hartnäckiges Verfolgen ist mit einem guten Miteinander vereinbar.
Beispiel gefällig? Angenommen, ich bin mal wieder an der Erfüllung meiner Ziele beschäftigt. Will eigentlich eine Radtour machen, die ich mir schon immer vorgenommen habe.
Doch während ich in den Sattel steige, da klingelt das Mobiltelefon. Ohjeh, Kumpel ruft an, Freundin hat Schluss gemacht, vorher das Konto geplündert, mitsamt Auto durchgebrannt. Whatever, Weltuntergang, kurzum: Meinem Kumpel, dem geht’s richtig mies. Er äußert den dringenden Wunsch, schnellstmöglich mich und mein offenes Ohr an seiner Seite zu wissen. Bestenfalls in Kombination mit Bier, das brauche er jetzt.
Und ich? Ich stehe – mal wieder! – vor einer Entscheidung. Mein Ziel zu erreichen, endlich die Radtour zu machen – oder meine Zeit nun damit zu verbringen, meinem Kumpel ein guter Freund zu sein.
Angenommen, ich teilte meinem Freund nun mit, er solle sich jemand anderen zum Ausheulen suchen, ich würde lieber Rad fahren: Dann wäre ich zwar überaus zielorientiert, aber gleichzeitig ein ziemlich schlechter Freund. Und ein egoistisches Arschloch obendrein.
Ich würde mich also ganz sicher dazu entscheiden, umgehend meinem Kumpel Beistand zu geben. Wie passt das jetzt zu meiner Theorie, dass es überaus erstrebenswert ist, stets allein das “eigene Ding” zu machen? Konsequent nur eigene Ziele zu verfolgen?
Ganz einfach: Ich gebe einem übergeordneten Ziel den Vorrang
“Ich will meinem Kumpel ein guter Freund sein” – hey, ist das nicht auch ein Ziel? Jawollja, ein für mich sogar sehr wichtig ist. So wichtig sogar, dass ich ihm das Ziel der Radtour unterordnete, und statt ins Grüne postwendend zu meinem Kumpel fahre.
Somit habe ich also meinen eigenes, hier übergeordnetes Ziel, erreicht. Und damit “mein Ding gemacht”. Ganz ohne Egoist zu sein.
Wichtig soll es für mich vor allem sein, unabhängig zu sein. Das heißt auch explizit: Unabhängig von anderen Menschen.
Dass ich kein Egoist bin, hätten wir ja nun geklärt.
Bin ich nun aber ein verquerer Einzelgänger, gar ein Soziopath?
Nein, bin ich ganz sicher nicht. Ich freue mich über jeden, der mich bei der Umsetzung meiner Ziele teilt. Der bestenfalls sogar das gleiche Ziel verfolgt, einen Ausflug zu machen zum Beispiel. Und ein solcher macht gemeinsam schließlich am meisten Spaß! Gilt natürlich auch für gemeinsame Foto-Streifzüge durch die Stadt, größere Projekte und Abenteuer.
Ich möchte meinen Ausflug (also mein Ziel) aber auch nicht von anderen abhängig machen. Und mach’ ihn deswegen eben alleine. Dafür schlag’ ich dann eben auch Verabredungen aus, auf die ich keine Lust habe. Wenn ich eine Stunde lang joggen gehen möchte, dann hab’ ich erst später Zeit für Verabredungen zum Kaffee. Wenn ich Dienst habe, dann bin ich pünktlich auf der Arbeit – für die ich mich entschieden habe, um meine Existenz zu sichern.
Weil ich eben mein Ding machen möchte.
Für mich habe ich nun also definiert, was es bedeutet, das eigene Ding zu machen. Wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt: Respekt!
Mag sein, dass ich euch mit meinen langatmigen Ausführungen genervt habe. Mag sein, dass sich meine Zeilen lesen wie ein zweitklassiger Lebensratgeber. Dass all diese “Erkenntnisse” doch ziemlich banal sind. Vielleicht haltet ihr all das Geschriebene für Quatsch, wenn gar garniert mit Sauce.
Für mich aber war es wichtig, mir Gedanken über “das Ding” zu machen, diese festzuhalten. Ja, ihr ahnt es bereits: Das war ein Ziel von mir.
Dieses Ziel habe ich nun erreicht, der Beitrag ist vollendet.
Was jetzt noch fehlt, ist die Debatte:
Teilt ihr meine Definition und meine Gedanken?
Oder habt ihr laute Einwände, möchtet mir noch ein paar Denkanstöße liefern?
Bedeutet es für euch vielleicht sogar etwas vollkommen anderes, wenn ihr von euch behauptet, ihr würdet euer Ding machen? Und ist euer “Ding” vielleicht etwas vollkommen anderes?
Ich bin schon ganz gespannt auf eure Gedanken, die ihr mir gern per Kommentar zukommen lassen dürft.
Während ich diesen Text geschrieben habe, kamen mir zwei Menschen in den Sinn. Bei denen ich mich aus gegebenem Anlass nun kurz bedanken möchte:
Danke, Christian! Danke dafür, dass du mir gezeigt hast, wie herrlich einfach es ist, Tag für Tag “sein Ding” zu machen – nämlich ganz banal, indem du so konsequent Tag für Tag mit dem Hund am Weiher oder auf dem Feldberg warst.Einfach, weil es dir wichtig war. Das hat mir imponiert und mich dazu bewogen, mir selbst jeden Tag eine kleine Auszeit zu nehmen.
Danke, Monika! Danke dafür, dass du mir irgendwann von den Bedürfnissen erzählt hast. Von dem “tief in sich selbst horchen”, das manchmal so schwierig ist. Aber so wichtig, um Bedürfnisse zu erkennen und sich daraufhin Ziele zu setzen. Dank deiner Worte kann ich dies nun immer besser – meistens jedenfalls.
Dass ich vor meiner ersten Alleinreise ins Ausland ziemlichen Bammel hatte – das hatte ich euch ja bereits in einem kleinen Artikel gebeichtet.
Nun bin ich zurück, nun ja, zumindest fast: Ich sitze im ICE von Hannover nach Frankfurt (der Flug nach Niedersachsen war dann doch erheblich günstiger), und freue mich nach vier spannenden Tagen in Ungarn dann doch wieder ein klein wenig auf Heimatluft, den Anblick von Skyline und Main.
Ich hatte euch versprochen, euch kurz über meine Erfahrungen während meiner Solo-Reise zu berichten. Das mach’ ich gern in Form eines kleinen Videos, das ich gestern an meinem letzten Abend im Hostel aufgenommen habe.
Soviel sei gesagt: Ich habe es sehr genossen, so richtig rücksichtslos agieren zu können wie es sonst nur Daimler auf der Bundesautobahn sind. Keine Kompromisse machen zu müssen, bummeln oder auch eilen können, wie es mir beliebt. Allerdings, auch das muss ich sagen, ist es auf Dauer anstrengend, permanent Pläne schmieden zu müssen und Entscheidungen zu treffen.
All die schönen Momente, wie den, als ich am Ufe Margariteninsel saß, über die Donau hinweg auf das so eindrucksvolle Parlamentsgebäude blickte, und ganz Budapest nur so funkelte in der Abendsonne: Die hätte ich niemals erlebt,, hätte ich mich nicht von möglichen Urlaubs-Partnern unabhängig und einfach mein eigenes Ding gewagt. Und ich weiß nun, dass ich mich problemlos auch im Ausland vier Tage lang nicht zu langweilen brauche.
Keine Sorge, die volle Foto-Dröhnung, die bekommt ausschließlich meine Familie ab. Dennoch, ein paar meiner vielen schönen Eindrücke dieser zauberhaften Stadt an der Donau, die mag ich euch nicht vorenthalten.
Der Einfachheit halber präsentiere ich euch diese sortiert mach meinen Reisetagen. Viel Freude euch beim Anschauen!

Als mich die Rolltreppe von der U-Bahn hinauf auf das Budapester Pflaster spuckt, ist dies mein erster Eindruck: Ich bin überwältigt. Kaum zu glauben, wie prachtvoll und riesig die Gebäude hier sind. Die Dunkelheit tut ihr Übriges…

Direkt mein zweiter Eindruck ist dann lustigerweise ausgerechnet eine Telefonzelle. Ganz ehrlich mal, wer von euch weiß noch, was das ist? Immerhin der magenta-farbene Telefonhörer erzeugt ein gewisses Heimatgefühl bei mir.

Nicht minder prunkvoll auch die Synagoge im jüdischen Viertel. Kaum hier, schon bin ich sprachlos.

Die “Gozsdu-Höfe”, das ist ein Innenhofkomplex, in dem sich an warmen Tagen die gefühlte halbe Stadt tummelt. Plus all der Touristen, die dem Ruf der Donauperle gefolgt sind…

Wenn’s draußen kalt wird, weicht man gerne in die berühmt-berüchtigten “Ruinen-Bars” aus. Zum Beispiel in das “SZIMPLA KERT” – so habe auch ich es getan.

Die Mischung aus Verfall, Straßenkunst und verrückter Inneneinrichtung muss man wirklich gesehen haben. Absolut crazy…

Am zweiten Tag hab ich dann bei einer geführten Fahrradtour vier Stunden lang mit einer bunten Truppe die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt abgeradelt. Wie zum Beispiel den Heldenplatz, an dem nicht nur dieses schöne Museum zu bestaunen ist…

… sondern auch dieses Denkmal zu Ehren der ungarischen Staatsoberhäupter der letzten 1.000 Jahre.

Nicht weit entfernt ist auch das “Stadtwäldchen”, in dem ein Schloss als Sammelsurium verschiedenster Baustile errichtet wurde.

Wir machen Halt und blicken auf das größte Heilbad der Stadt:
Von der beeindruckenden Fassade des Széchenyi – Bades könnten sich die Titus-Thermen mal ‘ne Scheibe abschneiden!

Was in Frankfurt die Kleinmarkthalle, ist in Budapest Nagy Vásárcsarnok. Eine wirklich GROSSE Markthalle.

Irgendwann erreichen wir dann die Donau. Und als ich die Karlsbrücke erspähe, bin ich sprachlos.

Auch die Seitenansicht des berühmten Parlamentsgebäudes bringt mir meine Sprache nicht zurück…

… zu gigantisch und wunderschön ist das zweitgrößte Parlamentsgebäude Europas. Das größte steht übrigens in Rumänien – hättet ihr’s gedacht?

Auf Anraten meiner lieben Freundin Rita statte ich dem Westbahnhof einen Besuch ab. In der alten Schalterhalle scheint die Zeit stehen geblieben.

Am späten Nachmittag, nunmehr zu Fuß unterwegs, zieht es mich erneut an die Donau.

Erneut folge ich Ritas Ratschlag, mache einen Abstecher auf die Margariteninsel. Lasse mich am Donauufer nieder und genieße diesen zauberhaften Ausblick.

… und auch am Parlament MUSS ich einfach noch einmal vorbeischauen.

Abends streife ich durchs jüdische Viertel. Im Hinterhof eines ziemlich abbruchreifen Hauses steigt ‘ne wilde Party. Ich bestell’ ein Bier und schaue mir verstört wie belustigt die etwas “alternative” Gestaltung des Innenhofes an.

Den dritten Tag beginne ich mit dem Aufstieg des Burgberges. Und mit jeder Treppenstufe wird die Aussicht auf die Stadt da unten schöner.

Karlsbrücke und Parlament: Klassisches Postkartenmotiv, in echt noch schöner.

Oben angekommen: Etwas außer Puste bestaune ich die prachtvolle Burganlage.

Die unweit gelegene Matthiaskirche ist indes genauso sehenswert. Finden auch zahlreiche andere Touristen.

… hatte ich bereits erwähnt, dass es mir dieser Ausblick wirklich angetan hat?

Das nächste Highlight auf dem Burgberg: Die Anlagen und Türme der Fischerbastei scheinen einem Märchen zu entstammen.

Zurück geht’s mit der Standseilbahn, die laufmüde Touristen wie mich in wenigen Sekunden zurück ins Tal bringt.

Vorher schaue ich mir aber noch den Burginnenhof an.

Und – ihr habt’s geahnt – Blicke nochmals auf die Stadt hinunter.

Zurück auf Pester Seite: Die Basilika steht in ihrer Pracht dem bisher Gesehenen in nichts nach!
Ob alleine, zu zweit oder im Rudel: Solltet ihr Budapest noch nicht besucht haben, so solltet ihr’s dringend tun! Allein innerhalb vier Tagen lässt sich allerhand bestaunen und entdecken.
Budapest, das ist nicht nur eine Stadt voll wunderschöner Architektur. Budapest hat als Hauptstadt Ungarns darüber hinaus eine sehr bewegte Geschichte, deren Spuren noch allerorts in der Stadt zu finden sind.
Budapest ist aber auch eine unheimlich spannende Stadt, in rasantem Umbruch. Insbesondere der Kontrast im Jüdischen Viertel ist hierbei beachtlich; auf Hochglanz renovierte Prachtbauten wechseln sich am Straßenrand hier ab mit verfallenen Bruchbuden aus Sowjetzeiten.
In letzteren residieren tatsächlich auch zahlreiche der berühmt-berüchtigten “Ruinen-Bars”, die mittlerweile jedoch längst keine Insider-Tipps mehr sind und in denen sich überwiegend Touristen tummeln und am günstigen Bier erfreuen. Vielmehr scheint man das Konzept der “Ruinen-Bars” als Vermarktungs-Masche zu nutzen. Die “Locals”, die sind woanders – in kleinen, charmanten Bars, die ich über Google Maps entdeckt hatte und die mich verzückt haben.