Unter den fünf Hallendächern des Frankfurter Hauptbahnhofs kreuzen sich jeden Tag hunderttausende Geschichten. Niemand hastet einfach so und ohne Anlass über das schwarze Fake-Marmor des Querbahnsteigs, noch nie hat der Zufall jemanden durch die Tore der berüchtigten Verkehrsdrehscheibe getrieben. Über tausend Züge bringen von hier aus Geschäftsleute zu ihren Geschäftsterminen, Liebende zu ihren Geliebten und Reisende zu ihren neuen Abenteuern. Nicht zu vergessen natürlich all die Eisenbahner, die inmitten all der Regsamkeit ihr Geld verdienen. Zwischen Gleis 1a und Gleis 24 sucht man nach Anschlusszügen, Rat und einer kleinen Stärkung, manch einer auch nur nach leichter Beute oder einem Schlafplatz für die nächste Nacht. Über all jenen wacht Atlas, der die Last der ganzen Welt auf seinen Schultern trägt.
Auch Harry befand sich auf der Suche. Als junger Mann war er jemand, den man gerne einen „Schönling“ nannte, die Frauen mochten sein sorgsam zurückgekämmtes, schwarzes Haar, die tiefbraunen Augen mit dem wachen Blick. Beinahe hätte man ihn für einen Italiener halten können. Nun hatte der Zahn der Zeit freilich auch nicht vor Harry Halt gemacht. Der verbliebene Haarkranz auf dem Kopf hatte längst eine schneeweiße Farbe angenommen, und wie Harry morgens im Badezimmerspiegel feststellen musste, war der neugierige, fordernde Ausdruck seiner Augen einer Müdigkeit gewichen, die er sich selbst nicht erklären konnte. Auch die Gelenke machten nicht mehr mit, er machte, wie er fand, eine jämmerliche Figur.
So sah man ihn also in gebückter Haltung über die Bahnsteige des Hauptbahnhofs schlendern, im Zeitungkiosk, sich Zucker in den Kaffee rühren, an der Würstchenbude oder – ab dem späten Nachmittag – auf einer der Bänke sitzend, ganz vertieft in „seine“ Frankfurter Rundschau. An sieben Tagen in der Woche, ein „Wochenende“ gönnte er sich nie. So wie die große Abfahrtstafel in der Haupthalle oder die obligatorische, umgekehrte Wagenreihung war Harry über die Jahre hinweg ein Teil des Bahnhofsalltags geworden.
Den Zügen und Lokomotiven schenkte Harry ein ganz besonderes Augenmerk. Es hatte sich so viel verändert! Wehmütig dachte er an „seine Zeit“ zurück, als noch die stolzen Elloks der Baureihe 103 InterCity-Züge mit wohlklingenden Namen an den Prellböcken zum Halten brachten. All das war lange her; ein Vierteljahrhundert war seit seiner letzten Fahrt vergangen. Harry dachte oft an den Moment zurück, als er zum letzten Mal mit seiner Lokomotive am Stellwerk vorbeizog, als sein Zug ein letztes Mal langsam unter dem Schatten des Hallendachs verschwand, während der Prellbock von Gleis 9 unaufhaltsam näher rückte. Ein letztes Mal hatte er zum Führerbremsventil gegriffen, ein allerletztes Mal sicher und ruckfrei angehalten. Nicht nur einmal hatte er in den Jahren zuvor von diesem Moment geträumt und war schweißgebadet aufgewacht. Nun war es so weit gewesen. Zack, aus, vorbei. Eine kleine Delegation des Bw1 hatte ihn in Empfang genommen; der Personalrat lobte Harrys Verdienste für die Bundesrepublik, der Dienststellenleiter überreichte Blumen und einen kräftigen Händedruck. Harry hasste Blumen.
In den nächsten Wochen wurde Harry traurig. Nicht wegen der Blumen, die waren längst verwelkt – aber statt den „besten Jahren“, wie es immer hieß, brachen düstere Tage über ihn hinein. Anfangs hatte er sich noch mit Freude seinem über die Jahre auf die Ausmaße eines kleinen Wolkenkratzers gewachsenen Bücherstapel gewidmet: Hermann Hesse, J.M. Simmel, Stephen King. Doch irgendwann war auch das letzte Buch gelesen. Harry unternahm Spaziergänge an der Nidda, bis er jeden Grashalm beim Namen kannte, staubte die Vitrine mit den Modellen „seiner“ 103 ab, bestellte lächerliche Massagegeräte bei einem Shoppingsender. Eines Tages hielt er die Schwere nicht mehr aus, die ihn befallen hatte. Er verließ seine kleine Zweizimmerwohnung in der Eisenbahnersiedlung Frankfurt-Nied und machte sich auf zum S-Bahnhof. Den Weg kannte er blind. Es fühlte sich eigenartig an, wieder in einem Zug zu sitzen, doch als ihn der kieselgrau-orange Triebwagen auf den Tiefbahnsteig von Gleis 102 spuckte, fühlte er sich wie elektrisiert: Harry war zurück am Hauptbahnhof.
So folgten fortan alle seine Tage demselben Ritual. Nachdem er ausgeschlafen hatte – vor neun Uhr stand er selten auf – drehte er eine Runde um den Block, machte Besorgungen und bereitete sich anschließend ein kleines Frühstück zu. Die Haferflocken sogen sich voll Milch, schmierige Schlagersänger sangen auf HR 4 über die Liebe. Wenn ihn früher Kollegen auf den Umstand angesprochen hatten, dass er Junggeselle geblieben war, hatte Harry zu scherzen gepflegt: „Ich bin doch schon mit der Eisenbahn verheiratet!“ Nun musste er sich eingestehen, dass sein Spruch eine traurige Wahrheit beinhaltete. Nach den 12-Uhr-Nachrichten kämmte sich Harry das weiße Haar wie einst sorgsam zurück, nahm den olivgrünen Anorak von der Garderobe und polierte seine besten Schuhe. Dann trat er seinen „Job“ an.
Am Hauptbahnhof angekommen, ließ sich der alte Mann erst einmal treiben. Oft musste er aufpassen, nicht von rücksichtslosen Reisenden überrannt zu werden. Dass es die Leute heute auch immer so eilig hatten! Früher, grollte er, nahm man noch Rücksicht auf alte Menschen wie ihn. Immer wieder blickte er sehnsüchtig den ausfahrenden Zügen hinterher. Wenn sich die Türen schlossen und der Aufsichtsbeamte zur Säule schritt, um den Abfahrtsauftrag zu geben, schluckte er. Ihm würde niemals wieder jemand einen Abfahrauftrag erteilen.
Hin und wieder hielt er einen Plausch mit seinen „Kollegen“. In den ersten Jahren war er häufig noch alten Weggefährten begegnet, tauschte Anekdoten von den guten, alten Zeiten aus. Erzählte, wie er damals auf der Riedbahn mit acht klotzgebremsten Silberlingen trotz einlösiger Bremse ruckfrei zum Stehen kam. Wie er als junger Lokführer am Hauptgüterbahnhof auch mit 40 Achsen „ohne Luft“ sanft beifuhr, wie er mit der E50 bei Wind und Wetter 3000 Tonnen Heizöl über die Spessartrampe zerrte, wie er mit dem TEE nach München einmal 30 Minuten Verspätung herausgefahren und die 103 am Fahrtziel beinahe AW-reif übergeben hatte. Die letzte Geschichte war gelogen, aber wen kümmerte das schon.
Doch im Laufe der Zeit traf er immer seltener auf bekannte Gesichter. Auch die Haudegen von einst wurden nicht jünger, setzten sich nach und nach zur Ruhe. Verabschiedeten sich in ihre Rentnerdomizile, pflanzten Gurken und Tomaten an, saßen mit der Gattin auf der Terrasse, spielten mit den Enkelkindern oder wenigstens Boule im Park. Allein Harry war übriggeblieben, ein gebückt durch den Bahnhof schlenderndes, olivgrünes Relikt der guten, alten Bundesbahn. Die Eisenbahner von heute waren anders, sie trugen schicke Uniformen, wirkten freundlich, aber gleichsam distanziert. Der Stolz schien ihnen auf eigentümliche Weise abhandengekommen. Oft blickten sie Harry skeptisch an, wenn er sich als einer von ihnen zu erkennen gab. Dann holten sie ihre Mobiletelefone aus der Tasche und wischten darauf hin und her, antworteten knapp oder täuschten Beschäftigung vor. Nur selten nahm sich einer Zeit, Harry länger zuzuhören. Immerhin, die Sprüche waren geblieben: „Das ist nicht mehr meine Eisenbahn!“, das hatte sein Lehrlokführer schon in den Fünfzigern gesagt.
Klar, es war nicht alles schlecht. Harry mochte das neue Dach des Hauptbahnhofs, besonders im Sommer, wenn die Sonne hell und freundlich durch die Scheiben fiel. Kein Vergleich zu damals, als das rußgeschwärzte Glas die Bahnsteige in schwarzgraue Tristesse tränkte. Auch die Bahnsteige wirkten sauber und modern, wenn auch der grassierende Reinlichkeitswahn Harry manchmal in Rage brachte. Daran, dass man nur noch in gelben „Hühnerkäfigen“ rauchen sollte, wollte er sich nicht gewöhnen. Harry rauchte überall, so wie sich das gehörte, und nahm den ein oder anderen Rüffel gern in Kauf.
Was er jedoch schmerzlich vermisste, waren die ratternden Fallblätter der Zugzielanzeiger. Stattdessen wurde die Bahnhofshalle mehr und mehr von einer unverständlichen und nervenzehrenden Kakophonie aus automatischen Ansagen geflutet, manchmal musste sich Harry die Ohren zuhalten, um nicht dem Wahnsinn zu verfallen. Nachdem Harry seine Runde gedreht und Smalltalk mit „Kollegen“ geführt hatte, holte er sich einen Kaffee bei Bäcker Eiffler, „gern mit e bisscher Milch“. Am Kiosk kaufte er sich eine Tageszeitung und wechselte ein paar freundliche Worte mit den Verkäuferinnen.
Nach der Lektüre nahm er eine Analyse des Betriebsablaufs vor: Wo waren die Anschlusszüge weg, wo die Wagenreihung umgekehrt, wo Ersatzzüge im Einsatz? Harry stand parat, wusste, wo die Luft brennt. Er entwickelte ein Gespür dafür, wann ein ratlos um sich blickender Reisender seine Hilfe brauchte. Dann gab er Verbindungsauskünfte (den jeweiligen Jahresfahrplan hatte er im Kopf), geleitete zu reservierten Sitzplätzen, zeigte den Weg zum Fundbüro. Manchmal bekam er zum Dank ein Geldstück in die Hand gedrückt, das er der Bahnhofsmission spendete. Wenn eine Lampe einmal streikte, war Harry der Erste, der den Defekt bemerkte. Freundlich wies er das Servicepersonal zur Reparatur an.
Nach Feierabend aß er in der Kantine zu Abend, die sich neuerdings „Casino“ schimpfte. Als Pensionär genoss auch er die erschwinglichen Preise und das täglich wechselnde, meist immerhin mittelgute Stammessen. Zumeist saß er allein am Tisch. Wenn er nach Hause kam, schaltete er augenblicklich den Fernseher an, er ertrug die Stille in der Wohnung nicht. Er trank zwei Gläser Meisterschoppen – mehr erlaubte der Arzt nicht – und zappte ein wenig durch das TV-Programm, das auch nicht mehr war, was es mal war. Dann ging er zu Bett und dachte daran, wie schön es war, gebraucht zu werden. Man brauchte ihn doch am Hauptbahnhof. Oder etwa nicht? Meist war er eingeschlafen, ehe er eine Antwort gefunden hatte.
So vergingen also 25 Jahre, in denen sich Harry mit der Gewissenhaftigkeit eines Deutschen Beamten auf den Weg zum Bahnhof machte. Nur wenige Male litt er an heftigen Erkältungen und anderen Wehwehchen, dann lag er auf dem Sofa, hatte ein schlechtes Gewissen und sehnte sich nach seiner Eisenbahnerfamilie vom Hauptbahnhof, der netten Frau vom Zeitungskiosk und der flinken Mannschaft der Bäckerei. Mal ganz zu schweigen von den Lokomotiven, die ihn noch immer faszinierten und denen er mit einer Mischung aus Wehmut und Stolz hinterher sah. Es wurde Winter, Frühjahr, Sommer, Herbst am Hauptbahnhof. Menschen, Momente und das Millennium flogen nur so vorbei. Bahnchefs, Krisen und Pandemien kamen und gingen, Harry blieb.
Doch in der Adventszeit 2022 änderte sich plötzlich seine Stimmung. Wie jedes Jahr hatte man den Hauptbahnhof festlich geschmückt, Lichterketten schmückten Pavillons und Tragwerke, kleine Tannenbäume funkelten von der Fassade des Empfangsbaus herab. An jedem Sonntag spielte eine Blaskapelle Weihnachtslieder vor dem Adventskalender, den man in der Haupthalle aufgestellt hatte. Obwohl der Bahnhof in diesen Tagen weniger Hektik als sonst versprühte, wirkten die Menschen eigenartigerweise noch gestresster, wenn sie bepackt mit schweren Koffern und Tüten über den Bahnsteig hetzten. Immer wieder bekam Harry zum Dank Schokoladenweihnachtsmänner zugesteckt, wenn er einer Dame beim Fahrkartenkauf behilflich war oder einen Zugbegleiter darum bat, noch einige Sekunden mit dem Schließen der Tür zu warten. Harry mochte keine Schokolade, und doch bedeutete ihm die Wertschätzung so viel. Trotzdem wurde sein Herz ein wenig schwer. Er konnte sich nicht genau erklären, was passiert war – aber es schien, als habe sich die Umlaufbahn seiner kleinen Welt um einen Millimeter geändert. Als sei in einem Schweizer Uhrwerk ein winziger Zahn eines Zahnrades gebrochen, als tickte die Zeit nicht mehr ganz richtig.
In diesen Tagen, als Harry häufig müde auf einer Bank saß und auf die Lichterketten starrte, bis sich funkelnde Punkte in seine Netzhaut brannten, reifte in Harry eine Idee heran. In einer Woche war Heiligabend – und er würde sich selbst mit einem Geschenk überraschen.

In der Nacht zum 24. Dezember 2022 schlief der alte Beamte unruhig. Immer wieder ging er in Gedanken das Gespräch durch, das er heute führen würde. Auf dem Weg zum Hauptbahnhof lächelte er und starrte auf den Schnee, der die Gleise des ICE-Werks mit weißem Puder bedeckt hatte. Der Stromabnehmer eines ICE 3 schlug an der vereisten Oberleitung Funken. Wann hatte er zuletzt weiße Weihnachten erlebt?
Am Ende seines „Arbeitstages“ suchte Harry nicht wie sonst die Kantine auf. Der Bahnhof war verlassen, kaum ein Reisender mehr zu sehen. Eine Truppe von Polizisten schritt mit grimmigen Gesichtern am Bahnsteig entlang; sie machten keinen Hehl daraus, dass sie gerade lieber bei ihrer Familie wären, statt Dienst zu schieben. Harry hob die Hand zum Gruß und wünschte Frohe Weihnachten. Als die Beamten außer Sichtweite waren, rauchte Harry zwei Zigaretten am Stück gegen die Aufregung. Pünktlich um 18.35 rollte der Intercity 2323 auf Gleis 16 ein, der Zughaken und die Luftleitungen der Lokomotive waren von Eisklumpen verdeckt. Als sich die Tür zum Führerstand öffnete, war Harrys Moment gekommen. Der Lokführer, ein junger Mann mit Irokesenschnitt und blond gefärbtem Haar, bemerkte ihn zunächst nicht. „So einen hätten sie bei der Bundesbahn aber nicht frei herumlaufen lassen!“, dachte Harry und besann sich auf seinen Plan. Er trat an den Mann mit der merkwürdigen Frisur heran. „Entschuldigung?“
Der Lokführer schien ihn nicht gehört zu haben. Offensichtlich hörte er Musik, denn er hatte zwei dieser neumodischen Stöpsel im Ohr stecken. Harry ließ sich nicht beirren und gestikulierte mit den Händen. Nun sah der junge Mann zu ihm auf und befreite sein Ohr vom Technikgedöns. „Ich bin hier nur der Lokführer, wenn Sie eine Auskunft brauchen, dann…“, begann er, doch Harry wiegelte ab. „Die besten Auskünfte erteile hier noch immer ich!“, begann er zu lachen. Der junge Kollege wirkte irritiert und sah ihn ein wenig unbeholfen an. „Frohe Weihnachten erstmal!“, wünschte Harry, während er ein altes Polaroid aus seiner Geldbörse nestelte. „Ich weiß, du möchtest an Heiligabend nicht von einem alten Mann belästigt werden. Doch ich bin einer wie du und habe einen Wunsch!“
Harry hielt dem Lokführer das schwarzweiße Foto vors Gesicht. Es zeigte ihn in seinen besten Jahren, wie er sich aus dem Seitenfenster seiner 103 beugte und den Bremszettel entgegennahm. Im Hintergrund zeigte die große Bahnhofsuhr am Stellwerk zehn nach Eins. Die Mine des Lokführers entspannte sich. „Oh, ein Kollege also! Ich wusste nicht, dass… Was kann ich denn für dich tun?“ Harry eröffnete ihm seinen Weihnachtswunsch. Nur einmal kurz, bat er, würde er gerne Platz auf dem Führersitz nehmen. Es würde auch nicht lange dauern. Nun lächelte der junge Mann, drehte sich um, öffnete die Tür der weißen Lokomotive und machte eine auslandende Geste: „Na denn hereinspaziert!“
Es dauerte ein wenig, bis Harry die Trittstufen genommen hatte. Seine Knie zitterten, als er sich mit einem Ruck die Griffstange hochzog und den Führerstand betrat. Sofort fiel ihm der Geruch auf, der so anders war als bei den alten Elektroloks. Irgendwie wie Plastik. Harry erschrak beinahe, als er in den Führersitz sank und dieser sein Gewicht sanft auffing. Die waren ja sogar gefedert heutzutage! Irre. Kein Vergleich zu den brettharten Schemeln, auf denen er selbst seinen Dienst verrichtet hatte. Er staunte, als er sah, dass dort, wo sich einst das MFA befunden hatte, nur mehr ein Display übrig war. Und, überhaupt: Das gesamte Pult war voller Displays! Harry strich über den Fahrschalter, berührte vorsichtig das Führerbremsventil und traute sich nicht zu fragen, wo denn der E-Bremssteller geblieben war.
So saß Harry einfach da, die linke Hand auf dem Fahrschalter und den Blick aus dem Frontfenster gerichtet. Er hätte nicht sagen können, ob für fünf Minuten oder Stunden. Das hier war sein Platz und würde es immer bleiben. Der Lokführer saß auf dem Beimannsitz und ließ ihn gewähren. Eine Träne kullerte Harrys Wange hinab, als er aufstand und dem jungen Mann die Hand reichte. Sein Händedruck, dachte er, war auch mal kräftiger. Aber so war das eben mit dem Älterwerden. „Ich danke dir so sehr!“, verabschiedete er sich. „Du hast einem alten Mann gerade eine große Freude gemacht. Einen ordentlichen Haarschnitt solltest du dir trotzdem verpassen lassen, aber vorher brauch´ ich deine Hilfe!“
Der Lokführer hielt ihn an den Oberarmen fest, bis Harry wieder festen Boden unter den Füßen hatte. „Und nun schnell ab zu deinen Liebsten, es ist schließlich Heiligabend!“, sagte Harry und gab dem jungen Mann einen Klaps auf die Schulter. Sein Plan war aufgegangen.
Der junge Kollege entschwand in Richtung der U-Bahn, und auch Harry stand bereits auf der Rolltreppe hinab zur S-Bahn, als er einen weiteren Plan fasste. Heute würde er seinen geliebten Apfelwein nicht allein trinken!
Kaum unten angekommen, machte Harry auf dem Absatz kehrt und fuhr wieder hinauf. Er verließ den Hauptbahnhof, überquerte die Straße und betrat das Bahnhofsviertel. An Heiligabend wirkte sogar das berüchtigte Viertel ein wenig friedlicher als sonst, nur einige verlorene Gestalten saßen auf dem Bürgersteig und starrten in den Nachthimmel. Nach fünf Minuten stand er vor dem „Moseleck“, wo er früher das ein oder andere Feierabendgetränk mit seinen Kollegen zu sich genommen hatte. In den Mosaikfenstern der Kneipe strahlten Lichtersterne, das schmutzige Schild über dem Eingang versprühte noch mehr Patina als bei seinem letzten Besuch: „Warme Küche – geöffnet von 06.00 – 04.00 Uhr Früh“.
Harry trat ein und rieb sich die Hände. Er genoss die Wärme der Gaststube und blickte unsicher umher. Es schien, als sei er nicht die einzige verlorene Seele, die Heiligabend nicht allein verbringen wollte. Die emsige Kellnerin flitzte mit vier Gläsern Binding in Richtung von vier Herrschaften, die sich dem Kartenspiel gewidmet hatten und sich Begriffe zuriefen, die Harry nicht verstand. Zwei Männer stritten sich an der Jukebox: „Wenn du noch ein einziges Mal „Driving Home for Christmas spielst, dann hau´ ich dir aufs Maul!“, unterband der Eine den Versuch des Anderen, die Weihnachtsstimmung etwas anzuheizen. Harry suchte sich einen freien Platz am Tresen und entledigte sich seines grünen Anoraks. Kurze Zeit später stand ein Glas Apfelwein vor ihm. „Frohes Fest“, sagte Harry leise zu sich selbst, nahm einen Schluck und lächelte. Er hatte noch mal vorne rechts gesessen. Dort, wo er hingehörte.
–
„Wenn ich´s Ihnen doch sage, der gute Kerl hat nur gesagt, dass er müde sei und nur mal kurz die Augen zumachen müsse!“ – die Kellnerin wirkte aufgeregt und zog nervös an ihrer Zigarette, während sie die Frage der Beamten zum x-ten Mal beantwortete. „Es gab also keine Anzeichen, dass sich der Herr in einer medizinischen Notlage befand?“, fragte der Wortführer der beiden Polizisten und machte sich Notizen auf einem Klemmbrett. „Ei, ich hab´s doch schon so oft gesagt: Der hat wirklich ganz normal auf mich gewirkt! Der hat einfach seinen Schoppen getrunken, und plötzlich hat er sein´ Kopf aufm Tresen abgelegt. Ich hab´ noch gefragt, ob alles gut sei, da sagt er jaja, ihm gings gut, er sei nur müd. Der hat auch net aufgeregt gewirkt oder so, wenn ich mich so erinner´, dann hat er sogar ganz glücklich geguckt, wenn net gar gelächelt!“
Der Kommissar nickte knapp. „Gut, Frau Evanowa, das war´s dann erst mal!“
Dann wandte er sich dem Notarzt zu, der den Tresen dazu benutzte, um den Totenschein auszufüllen. „Nichts mehr zu machen, gell?“ Der Mediziner schüttelte mit dem Kopf. „Keine Spuren von äußerer Gewalteinwirkung zu erkennen. Scheint so, als wäre Harald Nickel einfach für immer eingeschlafen.“
So trat der Lokomotivbetriebsinspektor seine allerletzte Reise an. Die Polizeibeamten und die Kellnerin standen vor der Kneipe und blickten dem Leichenwagen hinterher, bis er auf der Höhe des Hauptbahnhofs in der Dunkelheit verschwand. Es hatte wieder zu schneien begonnen, zarte Flocken segelten auf das harte Pflaster des Bahnhofsviertels. Von drinnen waberte ein Lied herüber, die Jukebox spielte „Driving Home for christmas“. Auf dem Vorfeld des Hauptbahnhofs gellte ein Pfiff.

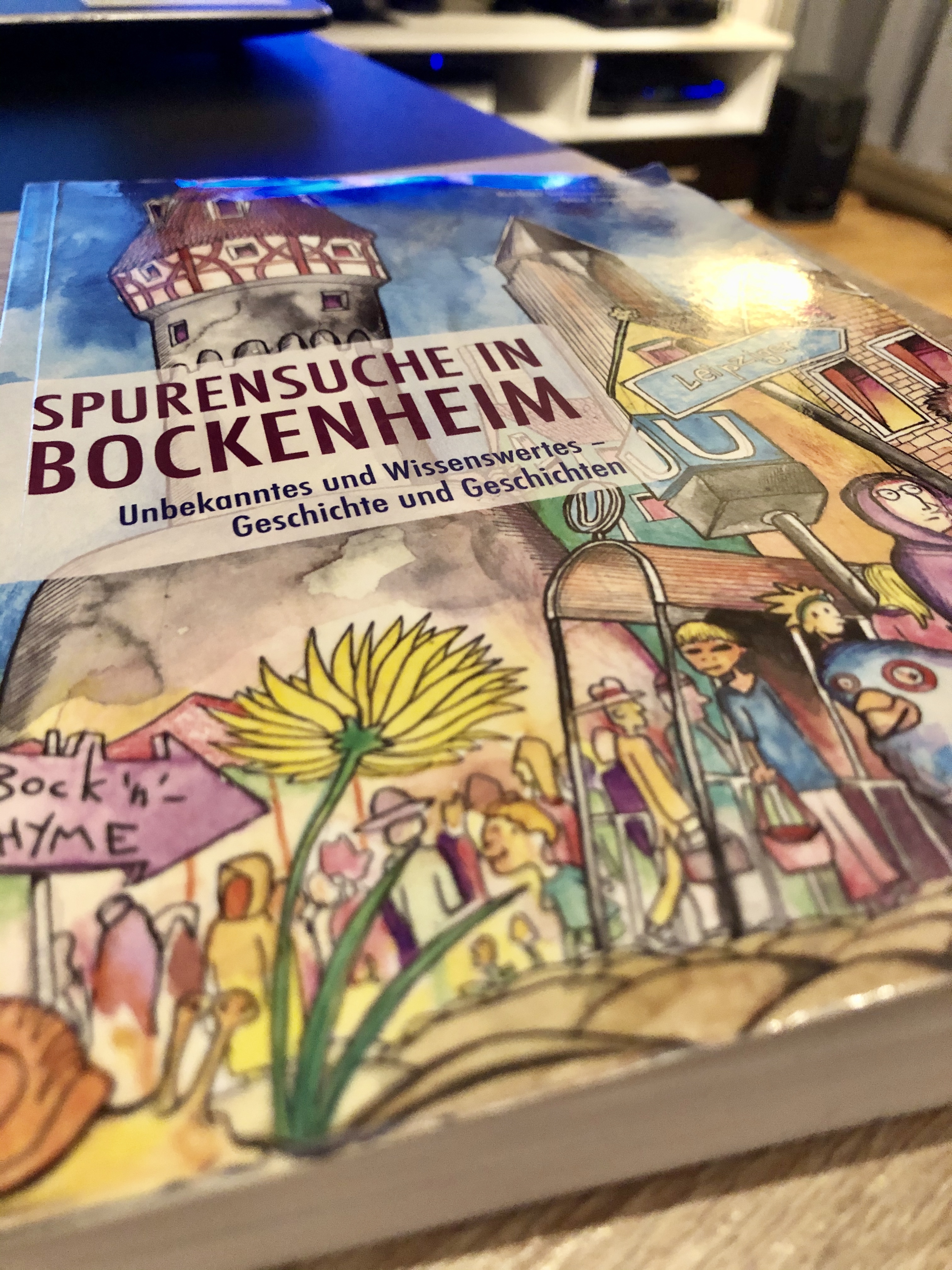

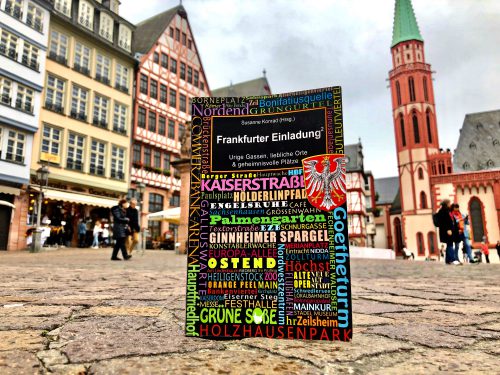

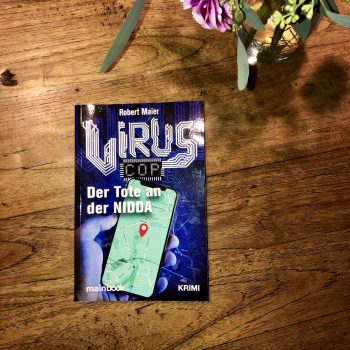

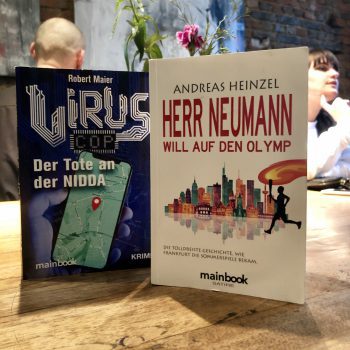












 Kaum haben wir den Treffpunkt erreicht und unsere Zweiräder verschlossen (in Offenbach weiß man ja nie!), müssen wir uns arg wundern. Einen “Marktplatz”, den hätten wir uns, nun ja, anders vorgestellt: Keine Spur von Marktbuden und freundlich dreinblickenden Damen in grünen Kittelschürzen, welche mit einem herzlichen Lächeln im Gesicht den Bund Möhren überrascht.
Kaum haben wir den Treffpunkt erreicht und unsere Zweiräder verschlossen (in Offenbach weiß man ja nie!), müssen wir uns arg wundern. Einen “Marktplatz”, den hätten wir uns, nun ja, anders vorgestellt: Keine Spur von Marktbuden und freundlich dreinblickenden Damen in grünen Kittelschürzen, welche mit einem herzlichen Lächeln im Gesicht den Bund Möhren überrascht.
 Bevor wir allerdings von dannen ziehen, gibt’s allerdings noch ein wenig Freestyle-Rap der Künstler. Ich kenn’ das schon als Einlage von
Bevor wir allerdings von dannen ziehen, gibt’s allerdings noch ein wenig Freestyle-Rap der Künstler. Ich kenn’ das schon als Einlage von 

