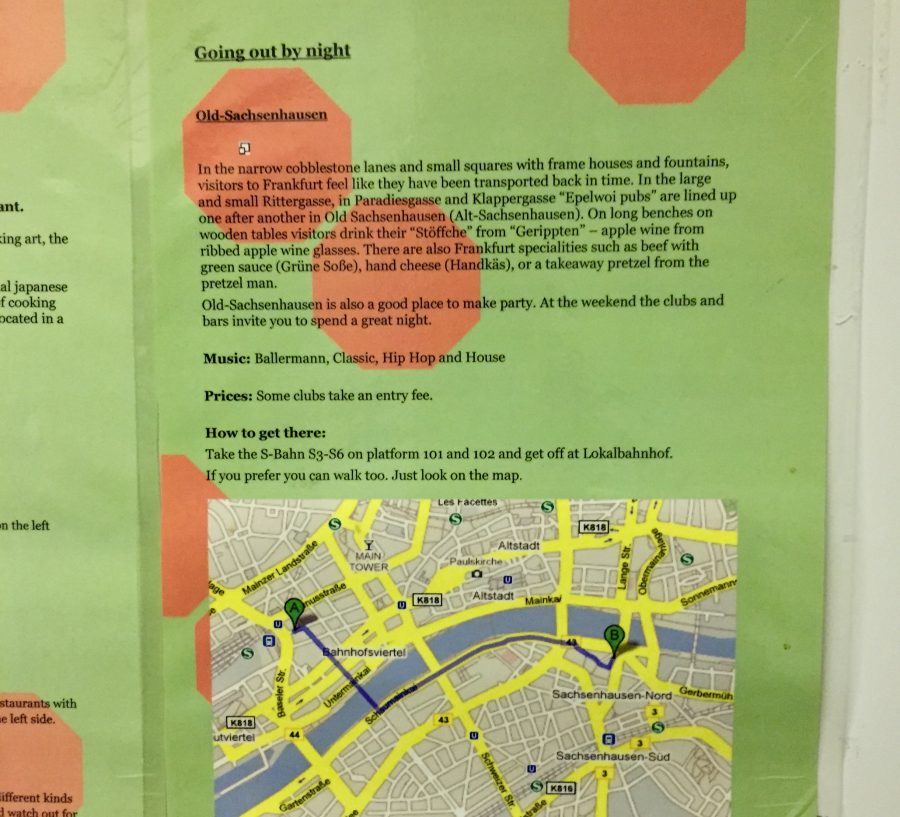Vielleicht erscheint es euch bereits heute unvorstellbar:
Es gab mal eine Zeit, in der an Ryanair, Easyjet & Co. noch nicht zu denken war. Als Fliegen noch ein überaus teures Privileg war, das nur Wenigen vergönnt war.
Eine Zeit, in der nicht überall auf der Welt jederzeit ganze Mietwagenflotten darauf warteten, um von Urlaubern preiswert genutzt zu werden.
Doch auch damals schon verspürte der reiselustige Deutsche den Wunsch, das Urlaubsland mit dem Auto zu entdecken. Und ein eigenes Auto, das hatte damals schließlich noch nahezu jeder. Nun war es aber wahrlich kein Vergnügen, die lange Anreise ins Urlaubsland auch im eigenen Mobil zu bestreiten. Auch an Pauschalreisen wagte damals schließlich noch niemandem ein Begriff.
Man glaubt es kaum, aber bereits vor über 80 Jahren hatte die damalige Deutsche Reichsbahn eine ganz schlaue Idee:
Warum sollten die Autos nicht auf Transportwagen an Zügen verreisen, in deren Schlafwagen die Urlauber entspannt der Sonne entgegen schlummerten? Das System der “Autoreisezüge”, so nannte man dieses pfiffige Konzept, erfreute sich schnell großer Beliebtheit in der Bevölkerung. Kaum wunderlich, schließlich lagen die Vorteile auf der Hand: Man kam morgens ausgeruht an Adria, Algarve oder kroatischer Küste an und konnte nach einem ausgiebigen Frühstück im Zug direkt mit dem eigenen Auto losdüsen.
Von Neu-Isenburg aus in die schönsten Regionen Europas
Aufgrund der wachsenden Nachfrage baute die Deutsche Bundesbahn in den Nachkriegsjahren schnell aus: Von Deutschland aus erreichten die Urlauber schnell und komfortabel begehrte Ferienregionen innerhalb der Nachbarländer. Und natürlich verspürten auch die Frankfurter – das Wirtschaftswunder noch im Rücken – eine nie zuvor gefühlte Reiselust.
Da bereits in den späten 1950er Jahren das Frankfurter Eisenbahnnetz an den Grenzen seiner Kapazität angelangt war, hat die Bundesbahndirektion Frankfurt eine im wahrsten Sinne des Wortes naheliegende Entscheidung getroffen:
Der Bahnhof des benachbarten Neu-Isenburg sollte zum Autozug-Bahnhof ausgebaut werden. Verladerampen wurden errichtet, eine Wartehalle samt Café wurde errichtet. Neue Gleise für die aufwändigen Rangiermanöver wurden verlegt, ein entsprechendes Reisebüro eröffnet.
Der Bahnhof Neu-Isenburg war fortan also Ausgangspunkt für all die Urlauber des Rhein-Main-Gebiets, die ihr Gefährt “huckepack” auf dem Zug mit auf die Reise nehmen wollten.
Narbonne in Frankreich, Westerland auf Sylt, Allesandria in Italien oder auch in die Alpen nach Schwarzach: All diese Urlaubsorte waren neben zahlreichen anderen schnell von Frankfurts kleiner Nachbarstadt zu erreichen.

Daran erinnerte über Jahrzehnte hinweg auch die himmelsblaue Bemalung des Bahnhofsgebäudes, die um Motive aus den von hier aus angefahrenen Ferienregionen ergänzt wurde. (Bild: www.gueterbahnhof-neu-isenburg.de)
Irgendwann jedoch begann mit dem Aufkommen des Pauschaltourismus der Niedergang des Autozuges. Fliegen wurde erstmals erschwinglich, Billigflieger taten später ihr übriges. Statt ins benachbarte Ausland machten die Deutschen nun lieber gleich am anderen Ende der Welt Urlaub. Karibik statt Korsika, das war nun die Devise – und spätestens, als dann überall auch noch günstige Mietwagen zu finden waren, war der “gute, alte Autozug” schlicht überflüssig.
Und so ereilte schließlich auch Neu-Isenburg das Schicksal der Autozug-Verladebahnhöfe: Am 26. Oktober 2014 lief der “AZ 53370” aus Narbonne ein und beendete das jahrzehntelange Kapitel des Autoreisezugverkehrs ab Neu-Isenburg.
Die himmelsblaue Fassade des Bahnhofsgebäudes wich samt den schönen Motiven einem Einheitsweiß, sodass heute nur noch das längst geschlossene Wartegebäude sowie die alten Rampen an all die freudigen Urlauber erinnern, die hier ihre Reise begonnen hatten.
Wenn ich heute, im Jahre 2017, vor dem Bahnhofsgebäude stehe, mir die verfallenden Anlagen anschaue: Dann werde ich ein wenig wehmütig.
Und wenn ich dann noch meine Augen schließe, dann erinnere ich mich an die Geschichte eines jungen Lokführers, der einmal frühmorgens um 4 noch recht verschlafen im Taxi saß. Auf dem Weg vom Frankfurter Hauptbahnhof nach Neu-Isenburg war. Er sollte dort einen Autozug aus Italien zu übernehmen, neue Urlauber samt ihren motorisierten Zwei- und Vierrädern mit an Bord nehmen und bis Hildesheim zu bringen, wo ein Kollege ihn ablösen würde und er einen ICE zurück nach Frankfurt nehmen würde. Das Ende der Autozüge war bereits absehnbar, der Fahrplan bereits entsprechend ausgedünnt. Es war, sagen wir mal, irgendwann im Sommer 2011.
Und die Geschichte, die geht so…
Nein, mitten in der Nacht aufstehen und zum Dienst eilen müssen, das war noch nie meins. Daran werd’ ich mich wohl nie gewöhnen. Ich sitze im Taxi, sehe die dunklen Fassaden des Gutleutviertels an mir vorüberziehen. Der Taxifahrer scheint munterer als ich, schert er sich doch jedenfalls herzlich wenig um jegliche innerstädtischen Geschwindigkeitsbegrenzungen. Ich habe andere Probleme: Ich brauche Kaffee. Viel Kaffee. Und hoffe, dass ich in Neu-Isenburg am Bahnhof noch welchen ergattern kann, bevor meine Fahrt nach Hildesheim beginnt.
Wir erreichen den noch in Dunkelheit gehüllten Bahnhof, vor dem aber bereits großer Trubel herrscht. Urlaubstrubel, um genau zu sein. Auf dem großen Parkplatz vor der Wartehalle stehen bereits brav Autos Schlange, um auf die bereitstehenden Transportwagen verladen zu werden. Motorräder stehen daneben, ihre stolzen Besitzer sind offensichtlich trotz der unchristlichen Uhrzeit bereits in bester Urlaubsstimmung und rauchen Zigaretten in Lederkluften. Ich trage derweil auch Leder, allerdings in Form meiner Uniformjacke, die mich als Lokführer ausweist.
Zielsicher steuere ich auf die kleine Tür im Erdgeschoss des Empfangsgebäudes zu und klingele. Ein alter Mann mit sanftem Blick in seinem verlebten Gesicht öffnet mir die Türe und mustert mich. “Lokführer?” fragt er mich. “Jau”, sag ich. “Für den 13370 nach Westerland”. Er nickt. “Na denn komm’ mal rein! Gibt auch Kaffee!”.
Wärme und Kaffee. Ich bin glücklich. Der Kaffee sollte sich zwar als bluthochdruckfördernder Filterkaffee “alter Schule” herausstellen, aber soll ja schließlich wirken, nicht schmecken. Ich folge dem Kollegen, er führt mich in sein Büro, bietet mir Platz an und reicht mir eine dampfende Tasse Kaffee. Ich schmunzele, als ich das Logo der Deutschen Bundesbahn auf ihr entdecke. Wohl schon was älter.
“Kannst auch noch eine Tasse trinken oder auch zwei”, sagt der Kollege. “Dein Zug hat eine gute Stunde Verspätung. Wieder irgendwelche Verzögerungen an der Grenze. Na ja, die Italiener eben. Kennt man ja.”
Ich bin fast ein wenig froh um die Verspätung. Noch ein bisschen Augenpflege vielleicht, ein paar Kaffee hinterher – das erscheint mir als angenehmere Aussicht als eine unmittelbare Dienstaufnahme. Auch die Urlauber draußen vor dem Fenster scheinen die Verspätung gelassen zu nehmen.
Ich nutze die Zeit, um mich ein wenig im Büro umzuschauen. Es scheint mir auf den ersten Blick zur Tasse in meiner Hand zu passen. Irgendwie aus der Zeit gefallen, als seien die Uhren hier irgendwann einfach stehen geblieben. In den “guten, alten Zeiten der Bundesbahn”, von der die älteren Kollegen immer so schwärmen.
Mein Blick streift unendliche Reihen von Akten, fein säuberlich beschriftet und verfrachtet in riesigen Regalen. Ich versuche, die Buchstaben zu entziffern. “Westerland 1977”, lese ich da. “Villach 1981”, “Paris 1984”, “Narbonne 1986”.
Auf dem gewaltigen Schreibtisch stehen unzählige Stempel, fein gespitzte Bleistifte liegen daneben. Und darüber, da tickt lautstark eine alte Bahnhofsuhr. Nein, ich sitze hier nicht verschlafen in einem Büro, befinde ich.
Vielmehr befinde ich mich in einer Amtsstube, in einem Relikt aus der Bundesbahnzeit, einem Bilderbuchbeispiel für deutsches Behördentum.
Mein Kollege bemerkt meine neugierigen Blicke, bietet mir eine Zigarette an. “Hab’ eigene”, sage ich. “Aber Danke dir!”. Er nickt, stellt einen bereits überquellenden Aschenbecher zwischen uns, gibt mir Feuer. Klar, in einer richtigen Amtsstube, da schert man sich herzlich wenig um seit Jahren gültige Nichtraucherschutzgesetze am Arbeitsplatz.
“Alles fein säuberlich aufbewahrt”, bricht er unser Schweigen, “so wie sich das gehört. Er deutet auf ein großes, vergilbtes Plakat an der Wand, das ich jetzt erst entdecke. “Netzplan Autoreisezugverkehr, Winterfahrplan 1977/1978” steht darauf. Farbige Linien verbinden Städte in ganz Europa, und irgendwo – relativ in der Mitte – ist mit rotem Filzstift die Station Neu-Isenburg eingekreist.
“Tja, damals war von hier aus noch die ganze Welt erreichbar”, seufzt mein alter Kollege. “Und der Netzplan, der hängt dort, seit ich hier angefangen habe. Seit 1977 sitze ich hier auf meinem Stuhl und kümmere mich um die Bürokratie, damit andere in ihren verdienten Urlaub reisen können”. Er bläst blauen Rauch in mein Gesicht, ich gieße mir Kaffee aus der ebenfalls vergilbten Kanne nach. Ich überschlage kurz Jahreszahlen.
“Du sitzt schon seit 35 Jahren hier?”, frage ich verwundert.
“So ist es!”, seine Augen strahlen stolz. “Ich habe damals meine Junggesellen-Ausbildung bei der Bundesbahn gemacht, hier beim Bahnhofsvorsteher von “Isebursch”. Und als der in Pension ging – Gott habe ihn selig! – hab’ ich seinen Posten übernommen. Und seitdem sitz’ ich eben hier in meinem Reich.”
Ich staune. Und überlege, ob auch ich noch in 35 Jahren im Führerstand einer Lokomotive sitzen werde. Und ob ich das überhaupt möchte. Der alte Kollege spricht weiter. “Damals, da war hier noch richtig was los. Jeden Tag kamen Züge von überall hier an. Es wuselte noch von Rangierern, die für Isenburg bestimmte Autowagen hier abkuppelten, hier verladene Autos wieder anhängten. Die Autos stiegen hier auch mit um, wurden an andere Züge angehängt. Und dann wieder auf die Reise geschickt, irgendwohin, wo es schön ist”. Sein Blick ist nun ein wenig wehmütig, er starrt ins Leere. “Tja”, er haut auf den Tisch, “alles vorbei. Der Lauf der Zeit eben”. Der Autozugverkehr, der sei am Sterben, er sei sich ganz sicher, dass das Ende bald kommen würde. Und dann, sagt er, würde er hier “die Bude absperren”. “Für immer”. Und dann endlich in Pension gehen und selbst verreisen. Er sagt das nicht traurig – er sagt das mit einer inneren Zufriedenheit, wie sie nur ältere Menschen sie besitzen. Er scheint dankbar um seine Zeit hier zu sein. “35 Jahre”, sag’ ich, “da hast du bestimmt so einiges erlebt. Du könntest sicher Bücher schreiben!”
“Allerdings”, nun lacht er. “Die schönsten und traurigsten Geschichten, die sind mir aller hier passiert.” Er erzählt mir von einem Ehepaar, dass sich kurz vor der Abfahrt in den gemeinsamen Urlaub hier am Bahnhof dermaßen zerstritten hat, dass die Frau spontan die Flucht ergriff und der Mann seine Reise dann alleine antrat. All sein gutes Zureden habe da nix geholfen. Oder aber von einer Familie, die versehentlich den falschen Zug bestiegen hat, denen er aber auf dem kleinen Dienstweg einen kleinen Unterwegs-Umstieg ermöglicht hat und dafür gesorgt hat, dass ihr eigentlich gebuchter Zug an einem anderen Ort noch auf sie wartet. Aus dem Urlaub habe er ein Dankeschön-Schreiben erhalten, das habe er noch heute. Er klingt stolz. “Nur einmal”, fährt er fort, “da habe er großen Mist gebaut. Ein Auto einem falschen Transportwagen zugewiesen, sodass die Urlaubsfamilie vergeblich auf ihr Auto wartete, als sie in Italien ankam. Denn das war derweil nämlich irgendwo in Frankreich. “Das hätte nie passieren dürfen”, er beißt sich auf die Zunge.
Ich zucke auf, als sich die Türe öffnet. Ein junger Kerl in verschmierter Warnkleidung tritt ein. “Mahlzeit!”, begrüßt er mich, streift Handschuhe ab und greift zur Kaffeekanne. “Ladevorgang für den 13370 beendet!”. Mein Gegenüber greift einen Stapel Papiere, macht irgendwelche Vermerke. Stempelt irgendwas. Ich reiche dem jungen Kerl die Hand, “Moin, Kollege!”. Kollegen, das seien wir ja eigentlich gar nicht. Eigentlich sei er Student und das hier nur sein Ferienjob.
Klar, hätte ich mir ja denken können. Für die wenigen Zugpaare in der Woche dürfte es sich für die Deutsche Bahn kaum lohnen, festangestellte Verladehelfer hier vorzuhalten. Ebenso wie auch das Rangierpersonal: Während früher hier gleich zwei Rangierlokomotiven der Baureihe V60 (die wir Lokführer liebevoll als “dreibeiniges Stangenwirbeltier” bezeichnen) samt Personal fest stationiert waren, reist heute für jeden Zug eigens eine Rangierlok aus dem Hauptbahnhof in Frankfurt an. Und die Rangierarbeiten, die erledigt dann allein der Rangierlokführer. Tja, man spart eben wo man kann, muss ja seit 1994 Geld verdienen als Eisenbahn des Bundes. Bundesbahn, das war einmal. Außer eben in diesen vier Wänden hier.
Ich quatsche ein wenig mit dem Studenten, er studiert Germanistik. Und die Arbeit hier, die sei zwar körperlich anstrengend – dafür sei sie aber wesentlich besser bezahlt als ein Job als Kellner im Café. Und Trinkgeld, das bekomme er sogar manchmal auch. “Du weißt ja, bei Urlaubern sitzt die Brieftasche immer etwas lockerer!”, grinst er. Ich grinse mit, der alte Mann wirft einen Blick auf seinen Monitor. Röhre, kein TFT – aber immerhin: Ein Monitor.
“Kannst dich langsam fertig machen!”, sagt er. “13370 im Anflug, gerade Darmstadt durch”.
Ich ziehe meine Jacke an, trinke den letzten Schluck des bitteren Kaffees aus. Packe meinen schweren Rucksack, reiche dem alten Kollegen die Hand. “Hat mich gefreut”, ich verabschiede mich, “ich hoffe, wir sehn uns noch mal vor deinem Ruhestand. Solange die Autozüge noch rollen!”.
Ich trete aus auf den Bahnhofsvorplatz. “Sind Sie unser Lokführer?”. Aha, die Jungs mit den Motorrädern also. “Also, verkleidet hab’ ich mich nicht – meine Uniform ist echt!”, lache ich, die Jungs lachen mit. Ob sie denn nachher mal einen Blick vorne in die Lok werfen dürften, werde ich gefragt. “Na klar dürft ihr das!”. Man freut sich, jawoll, bis später. Ich laufe auf den Bahnsteig, sehe irgendwo am Horizont drei weiße Lichter vor der aufgehenden Morgensonne. Das muss er also sein, mein 13370. Das laute Brummen der Rangierlok ist bereits zu hören, sie befindet sich im Rangierbahnhof auf “Lauerstellung”, wartet mitsamt den Autotransportwagen auf den ankommenden Zug. Und auch ich muss nun durch die Gleise zum Rangierbahnhof laufen. Dort lösen wir Lokführer ab, mein Kollege wird dann herüber zur S-Bahn laufen und die Fahrt in seinen Feierabend antreten. Mit kreischenden Bremsen hält die alte Lokomotive vor mir: Eine Maschine der Baureihe 110, Baujahr 1956. Da war selbst mein Vater noch nicht geboren. Ich klettere auf den Führerstand, es ist angenehm überhitzt. “Alles in bester Ordnung!”, sagt der Kollege, nachdem ich ihm die Hand gegeben habe. Ich wünsche ihm einen schönen Feierabend, beginne meine Vorbereitungsarbeiten.

Als die Rangiermanöver beendet sind, führe ich gemeinsam mit dem Rangierlokführer eine Bremsprobe mit den neuen Wagen durch. Anschließend erhalte ich über Funk die Zustimmung des Fahrdienstleiters, zum Bahnsteig vorzuziehen. Die Urlaubsrückkehrer, die wollen hier schließlich noch aussteigen – und schließlich gilt es noch, die Urlauber aus dem Rhein-Main-Gebiet einsteigen zu lassen, damit ihre schönsten Tage des Jahres endlich beginnen können.
Ich halte am Bahnsteig, die junge Zugführerin steigt aus und eilt zu mir vor. Sie begrüßt mich mit einem “Morgen, lieber Lokführer!” und reicht mir lächelnd einen dampfenden Kaffee und ein Frühstück aus dem Speisewagen. “Damit du mir auch durchhältst bis Hildesheim!” Ich bedanke mich, sie macht eine kurze Sprechprobe mit ihrem Funkgerät. Und nun steht auch die Motorrad-Gang bei mir, schon ganz neugierig. Ach ja, da war ja was. Ich bitte sie, zu mir heraufzukommen. “Aber Einer nach dem Anderen, ist ziemlich eng hier drinnen!”.
Einer nach dem anderen blickt mit staunenden Blicken über den Führerpult. “Hat ja auch ein paar mehr PS als unsere Bikes”, wird da festgestellt. Und alle wollen sie mal auf meinem Führersitz platznehmen. Ob ich denn ein Foto von ihnen machen könne, von ihnen vorne auf dem Sitz des Lokführers. Für ihre Frauen. Na klar kann ich, die Jungs freuen sich, laden mich auf ein Bier im Speisewagen ein. Muss ich leider dankend ablehnen, Dienst ist schließlich Dienst und Schnaps ist schließlich Schnaps. Dabei ist auch egal, dass der Schnaps in diesem Falle nur Bier ist. “Aber, Moment…” nun kommt mir ein Einfall, “nachher in Hildesheim, da werde ich abgelöst. Wenn ich dann absteige, und ihr mir noch einen Kaffee nach vorne bringen könntet, dann wäre das der Revanche genug!”.
“Abgemacht!”, der Rocker und ich geben uns ein High Five. “Verlass’ dich drauf, ein Mann, ein Wort!”. Ja ja, die Rocker-Ehre. Ich bin doch ein Schlitzohr, denke ich in mich hinein. Und den Kaffee nach der Ankunft, den werd’ ich später ziemlich nötig haben!
Sämtliche Urlauber sind an Bord, ich melde dem Fahrdienstleiter die Fahrbereitschaft für den 13370. Das Ausfahrsignal zeigt freie Fahrt, ich drehe sachte am Fahrschalterhandrad. Die Fahrmotorlüfter laufen hoch, der Autoreisezug gen Westerland rollt an. Ein Blick auf meinen Fahrplan und meine Motorstromanzeigen, ein letzter Blick hinaus auf das Fenster der Amtsstube im Bahnhofsgebäude. Ich bediene der Pfeife der Lok, verabschiede mich mit einem lauten Pfeifsignal von meinem alten Kollegen. Und ich will nur hoffen, dass ich ihm nochmals begegne.
Und ebenso, da hoffe ich, dass ich auch irgendwann so zufrieden auf mein Berufsleben zurückschauen kann. So viel erlebt haben werde wie der alte Kollege. Irgendwann, wenn dann auch mal ich in Rente gehe. Und “die Bude zusperre”.
Aber erst einmal, da gilt es, Familien und Motorradfreunde sicher in ihren Urlaub zu bringen. Ach ja, und ihre Autos und Motorräder, die natürlich auch.
Das traurige Ende einer großen Ära
Vielleicht ist diese Geschichte nichts weiter als erstunken und erlogen. Vielleicht aber auch war ich selbst der junge Lokomotivführer war, der diese Geschichte irgendwann im Sommer des Jahres 2011 erlebt hat. Wie auch immer, ich denke gern an diese Geschichte zurück. Und genauso gern, da denke ich an den alten Beamten der sich mittlerweile längst in Pension befindet und hoffentlich endlich einmal selbst Urlaub macht. Und an die große Zeit der Autoreisezüge, die nun unwiderruflich vorbei ist.
An all das denke ich, wenn ich das einheitsweiße Bahnhofsgebäude und die verrammelte Wartehalle des Bahnhofs Neu-Isenburg heute 2017 anschaue. Werde ein wenig traurig, wenn ich den Verladerampen – einst Beginn von Urlaubsträumen – beim stetigen Verfall zuschaue.
Zeiten gehen vorbei, Momente werden zu Geschichten. Ich bin gespannt, was die Zukunft bringt.

























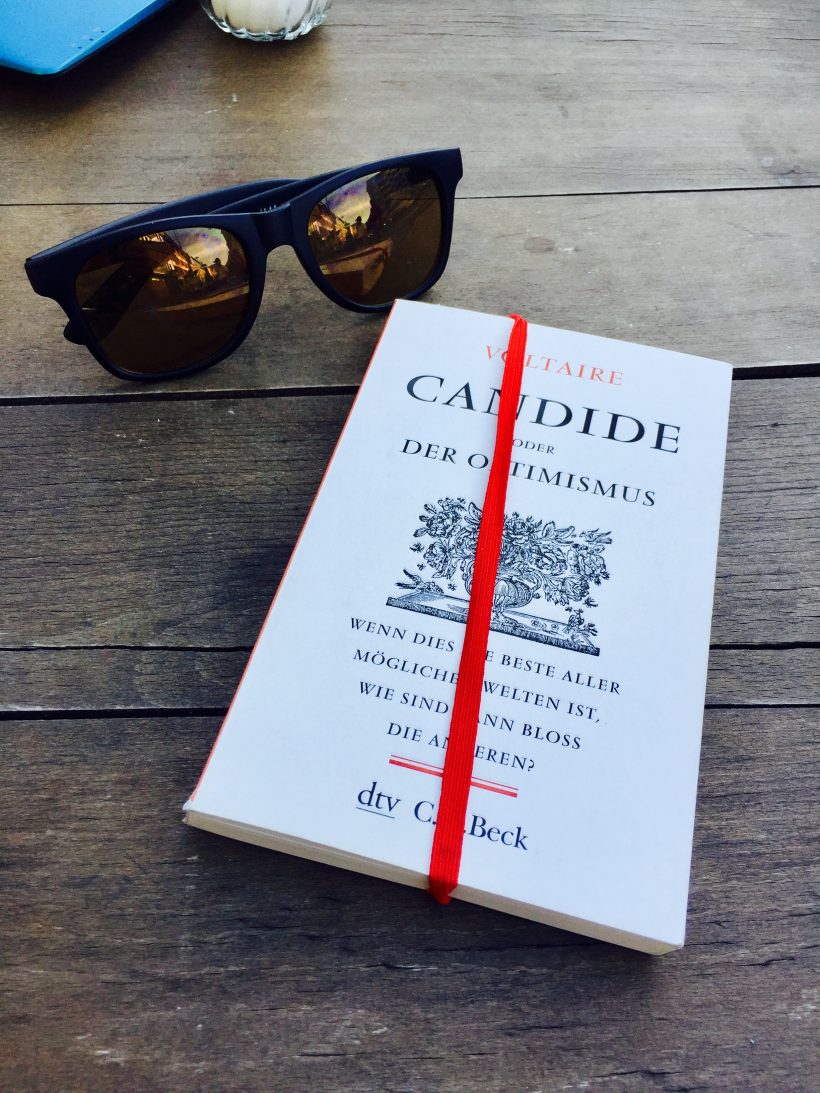 Voltaire ist es geworden, “Candide oder der Optimismus”, eine recht bekannte Erzählung des französischen Philosophen.
Voltaire ist es geworden, “Candide oder der Optimismus”, eine recht bekannte Erzählung des französischen Philosophen.