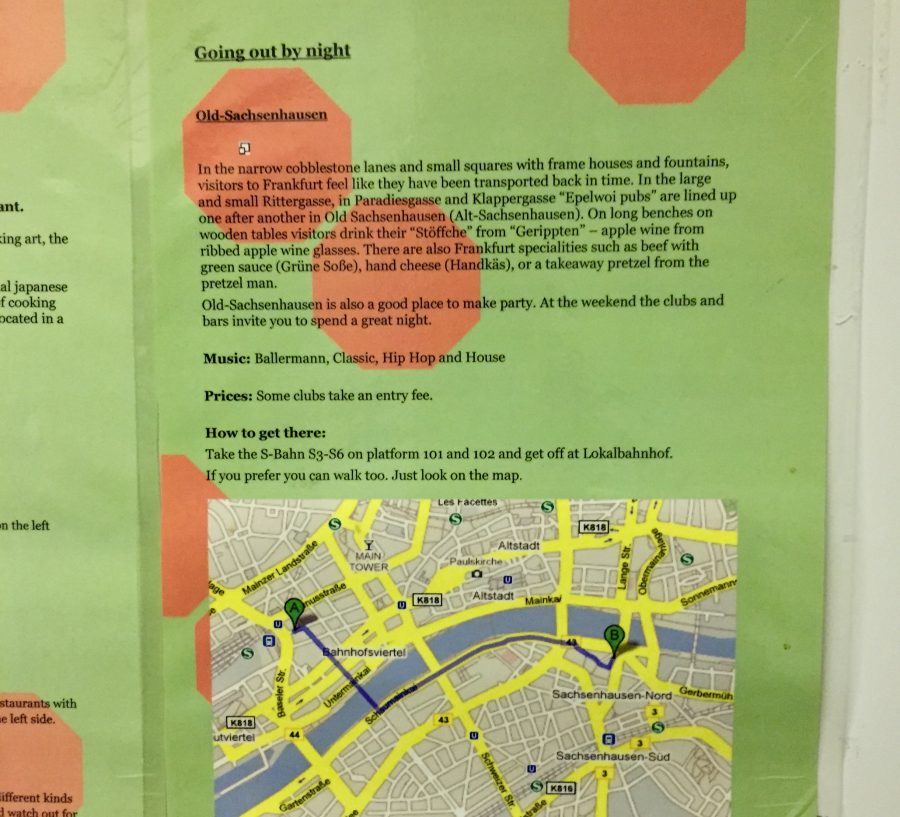Eigentlich, da bin ich ja “durch” mit dem Bahnhofsviertel.
Ja, ja: Ein Sündenpfuhl und hartes Pflaster, ein halber Quadratkilometer voller Leid, Schmutz und Elend. Dubiose Geschäfte und käufliche Liebe hinter schmucken Altbaufassaden. No-go-Area und von der New York Times “als Place to be gepriesen“, Hipster hängen in coolen Bars mit bunten Stühlen herum, während nebenan Junkies im Dreck und Dealer auf der Lauer liegen. Der Frankfurter Weg, eine überforderte Polizei im Schatten der Wolkenkratzer. Tabak-, Schuh- und Musikgeschäfte als die Letzten ihrer Art, der Einzelhandel stirbt auch hier. Gentrifizierung, BAO, die offene Drogenszene. Crack ist das neue Heroin und das Viertel der heiße Scheiß, dann und wann sorgt ein Künstlerkollektiv für Furore.
Frischer Fisch bei “Alim”, kaltes Bier bei “Yok-Yok”, ein Kiosk wird zum Kult. Ulrich Mattner mittendrin, Glücksspiel und benutzte Spritzen in den Straßen mit den Flussnamen. Einmal im Jahr die Bahnhofsviertelnacht, man schlemmt sich um die Welt, ja, das Viertel ist nicht nur multikrimi-, sondern seit jeher auch multikulturell. Bänker machen Mittagspause auf dem Kaisermarkt und Männer mit Kehrmaschinen und Hochdruckreinigern dem Dreck der letzten Nacht den Garaus.
Popup-Stores ploppen auf und lautlos wieder zu, die Dachterrasse eines “24 hours”-Hotels lädt zum Tanz, laute Musik übertönt das Blaulicht in der Straßenschlucht. Absteigen mutieren zu Kult-Kneipen oder müssen schließen, Bars von Weltniveau kredenzen Moscow Mule.

Erkennen Sie`s? Kaum wieder zu erkennen ist der Bahnhofsvorplatz auf einer der ausgestellten Bilder des Instituts für Stadtgeschichte.
Ausgepresst und Ausgequetscht
Das Bahnhofsviertel, es ist berüchtigt und hipp, ist verschrien und geliebt, ist arm und reich, ein makabres Schauspiel und marodes Tor zur Stadt. Ist grausam, ehrlich, liebenswürdig, ist spannend, unstetig, gefährlich. In graue Tristesse gehüllt und trotzdem bunt. Das Bahnhofsviertel, es ist Alles und Nichts, vor allem aber ist es: Totgeschrieben, ausgequetscht, immer für einen reißerischen Aufmacher gut gewesen. Bis zum Erbrechen diskutiert, als Politikum missbraucht in Wahlkampfzeiten, hat es polarisiert und mich irgendwann gelangweilt, hat gelegentlich sogar vergessen lassen, dass Frankfurt noch so viel mehr ist.
Nein, ich konnte und wollte irgendwann nichts mehr lesen über den zwischenzeitlich zum “BHFSVRTL” hochstilisierten Stadtteil, nicht auf Blogs, nicht in der Zeitung, nicht sonstwo. Wollte nicht meine heile Welt, doch zumindest bitte meine Ruhe.
Dass ich nun dennoch noch ein (allerletztes, versprochen!) Mal einreihe in all die Berichterstattung über das Viertel, hat einen ganz bestimmten Grund:
24 Rückblick – nüchtern, sachlich, überfällig
Die Ausstellung “Banker, Bordelle und Boheme” des Instituts für Stadtgeschichte. Diese ist noch noch bis zum 7. April 2019 im Ausstellungssaal des Karmeliterklosters zu bewundern, welches ohnehin jederzeit einen Besuch wert ist. An einem grauen Sonntagnachmittag hatte ich mich jüngst dazu hinreißen lassen, der Ausstellung einen Besuch abzustatten. Bereut habe ich es nicht – was nicht allein an meiner nette Begleitung lag! Vielmehr vor allem daran, dass die Ausstellung einen längst überfälligen, wohltuend nüchternen Blick auf die wechselhafte Geschichte des verruchten Viertels wirft. Gänzlich frei von wildgewordenen Emotionen, von Verteufelungen und den ewigen Hype wird Aufstieg und Fall des einstigen Nobelviertels beleuchtet.

Dabei wird der Wandel des Viertels auf 24 Stationen nachgezeichnet. Historische Fotografien des Instituts für Stadtgeschichte und Leihgaben anderer Fotografen machen Menschen wie mich glücklich, welche “Früher und Jetzt”-Vergleiche lieben.
Exponate in Schaukästen runden die Ausstellung ab – vom Fuchspelz als Zeugnis des einst florierenden Pelzhandels bis hin zur “Stadtkarte für Freier” samt “Leichte Mädchen-Testberichte” in Buchform. Letztere Gegenstände wirken aus heutiger Zeit betrachtet schlicht widerlich und machen die Errungenschaften von Aufklärung und Emanzipation deutlich – während sie gleichzeitig mahnen, diese zu schützen und bewahren.

Makaber: “Stadtkarte für Freier”
(Foto: Institut für Stadtgeschichte)
Für mich besonders aufregend war es, die prächtigen Bauten zu betrachten, welche im Krieg zu schaden kamen und nie wieder aufgebaut wurden. Wie prunkvoll das Viertel doch einmal anzuschauen war!
Tröstliche Erkenntnisse: Weil früher auch nicht alles besser war
Erfreulich auch, dass die politischen Ansätze im Umgang mit der das Viertel seit Jahrzehnten begleitenden Drogenproblematik aufgearbeitet wird. Nach einer Stunde atme ich frische Luft im Kreuzgang des Klosters. In mir macht sich die Erkenntnis breit, dass früher nicht immer alles besser war. Dass aber auch nichts beständiger ist als der Wandel, der auch vor dem Bahnhofsviertel keinen Halt macht – und neben Problemen jedoch auch Hoffnung schafft.

Prunkvolle Zeiten: Ob sie je zurückkehren? (Foto: Institut für Stadtgeschichte)
Was übrig bleibt, ist eine Frage: Quo Vadis, Bahnhofsviertel?
Banker, Bordelle und Boheme
zu sehen im Karmeliterkloster
noch bis zum 7. April 2019