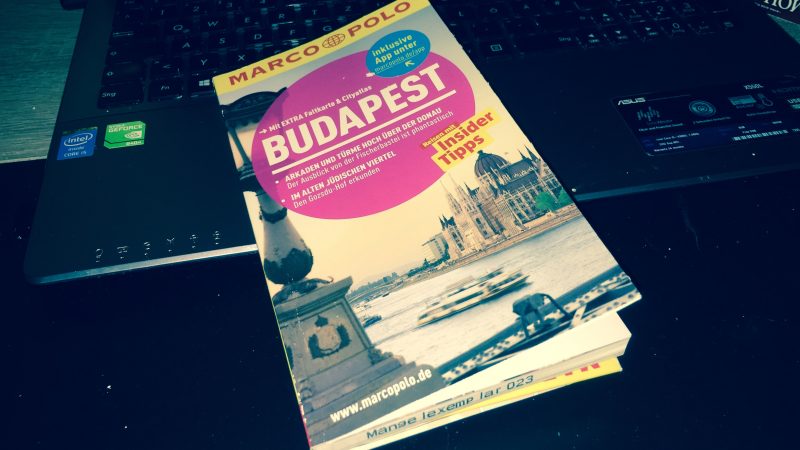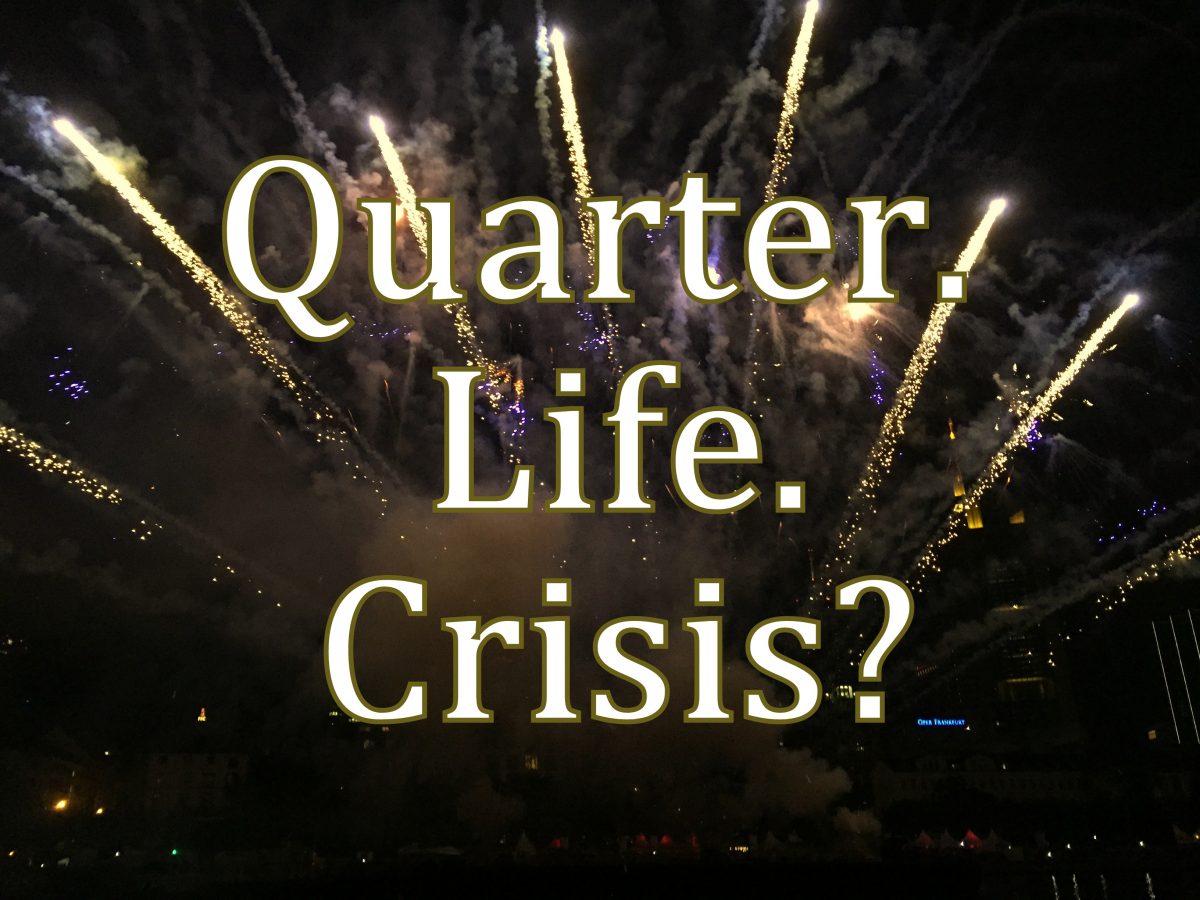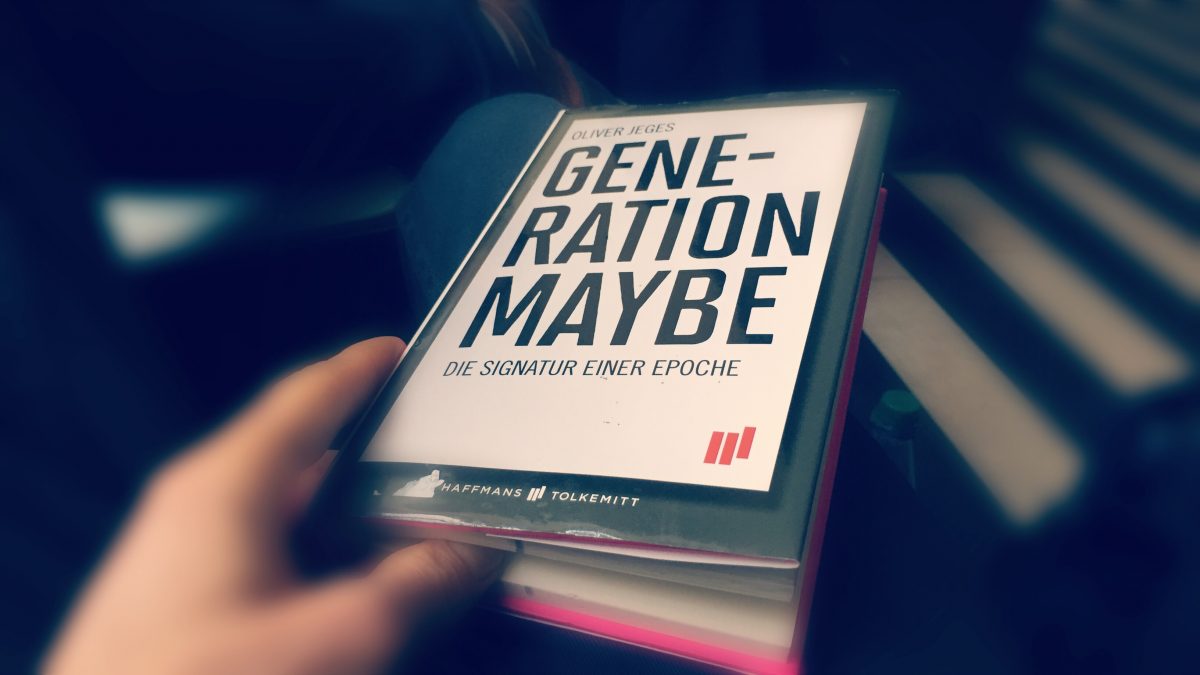Der aufmerksame Leser weiß natürlich längst:
Ich singe oftmals Lobeslieder auf unsere Heimatstadt am Main. Schwärme von einer Vielfalt, die auf nicht einmal 250 Quadratkilometern Stadtfläche dafür sorgt, dass selbst mir seltenst langweilig wird.
Von all den Möglichkeiten, die sich hier auftun, den unterschiedlichen Menschen, die ein einfaches Gespräch zu einem besonderen Moment werden lassen können. Und natürlich vom “Stadtrausch”, von einer Metropole im steten Wandel, vom immerwährenden Umbruch, all der Bewegung.

Dennoch muss ich hier mal klarstellen:
Es gibt auch Dinge, die ich hier schmerzlich vermisse.
Umstände, über die ich mich maßlos ärgere.
Tatsachen, die in anderen Großstädten unserer Republik undenkbar wären – oder längst selbstverständlich sind.
Und hey, da “BUZZFEED” bei den jungen, hippen Leuten von heute ja so angesagt ist, schließe ich mich diesem Trend freilich gerne an!
Et voilà, Vorhang auf und Bühne frei:
Hier ist es, mein Top 10 – Ranking der Dinge, die in Frankfurt einfach fehlen.
Platz 1: Bezahlbarer Wohnraum. Für alle.

Jawoll, dass es in Frankfurt insbesondere an bezahlbarem Wohnraum für alle Schichten der Bevölkerung mangelt, ist ein längst bekannter Umstand.
Der Anteil der städtisch geförderten Wohnungen schrumpft kontinuierlich, wogegen die Mietpreise der privaten Wohnungen ungehindert wuchern.
An diesem Umstand änderte auch die 2015 eingeführte und gefeierte “Mietpreisbremse” nichts. Im Gegenteil, im Städtevergleich ist für die heimischen Wände schon lange lediglich in München mehr zu berappen.
Das Vorhaben, neue Wohngebiete zu erschließen, gestaltet sich als Drama – nicht zuletzt begründet in der bereits hochverdichteten, kleinen Fläche der Stadt.
Und so werden auch weiterhin Wohnungssuchende verzweifeln, werden “Ur-Frankfurter” in die äußeren Stadtteile verdrängt, während die angesagten Bezirke der Innenstadt lediglich von besser verdienenden, oft Zugezogenen Menschen dominiert werden.
Eine gelungene “soziale Durchmischung” geht anders. Nicht sonderlich erfreulich – außer für Immobilienbesitzer.
Platz 2: Kneipenkultur

Wir Frankfurter haben unser “Wasserhäuschen”. Einst verschrien, wurde es unlängst als sozialer Treffpunkt, als Ort für Klatsch, Tratsch & Feierabend wiederbelebt. Eine Entwicklung, die mich durchaus erfreut!
Was wir dagegen nicht haben:
Eine echte Kneipenkultur. So wie generell in Frankfurt alles ganz besonders sein muss – in jüngster Zeit gerne in Form einer möglichst umfangreichen Craftbier-Karte, Tastings unzähliger Gin-Sorten oder auch lediglich von exorbitanten Preisen – so versuchen auch die meisten Bars und Kneipen, möglichst exklusiv zu sein.
Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass ich in diesem Augenblick, in dem ich diese Zeilen schreibe, in der “Kinly Bar” sitze. In der ich an meinem Old Fashioned schlürfe, dessen Vorzüglichkeit ihren berechtigten Preis hat.
Und gleichzeitig eine Sehnsucht nach den vielen vielleicht einfachen, aber lebhaften Kneipen verspüre, die ich in anderen Städten als selbstverständlich wahrgenommen habe.
Ja, wir haben verdammt gute Bars. Vermutlich sogar die beste Bar-Szene des Landes.
Wo aber sind all die gemütlichen Eckkneipen, die ein Jedermann aufsuchen kann, wenn nach dem Feierabend nicht der Sinn nach dem heimischen Sofa steht? Wo in der Nachbarschaft verbirgt sich hinter getönten Scheiben ein öffentliches Wohnzimmer, in dem auch unter der Woche erstmalige Besucher so herzlich aufgenommen werden, als gehörten sie längst zum Mobiliar?
Kneipen, in denen auch ein gewöhnlicher Dienstagabend noch bei Kaltgetränken, Gesprächen und Musik einen schönen Abschluss finden kann. Ganz ohne Extraveganz und prall gefülltem Portemonnaie.
Und nein, ich rede nicht von all den Absturz-Kneipen in Alt-Sachsenhausen, in denen Shots nur einen Euro kosten und der Vollrausch auch für 16-jährige Umlands-Bewohner mittels Taschengeld finanzierbar ist.
Nach sechs Jahren in Frankfurt am Main stelle ich fest:
Der gemeine Frankfurter trifft sich in angesagten Bars zu wahnsinnig guten, aber teuren Drinks. Trifft sich zum Essen im neu eröffneten Szene-Restaurant mit der exotischsten Lifestyle-Küche. Im Sommer auch gerne mal auf der Rooftop-Bar, versteht sich. Oder beim Afterwork, für dessen Besuch es erst einmal Eintritt zu errichten gilt. Hat ja schließlich seinen Preis, Bänkern beim Köpfen ihrer Champagner-Flaschen zuzuschauen.
Oder er bleibt gleich ganz zu Hause.
Was man hier dagegen viel zu selten macht:
Einfach noch mal raus gehen “auf’n Bier ums Eck”.
Gern auch alleine, weil man ja eh jemanden kennt. Und wenn nicht, eben kennenlernen wird.
In einer Kneipe, die wochentags nicht ausschließlich von dubiosen Gestalten an Spielautomaten bevölkert ist, in der bestenfalls sogar geraucht werden darf. Und in der irgendwann aus einer Laune heraus beschlossen wird, nach dem dritten Bier auf den Tischen zu tanzen.
Was am Wochenende kein Problem darstellt, offenbart sich hier von Montag bis Donnerstag zur einem echtem Mangel. Mag auch daran liegen, dass viele Studenten der Frankfurter Universitäten lieber nach Frankfurt Ein- und Auspendeln, statt hier zu leben. Womit wir wieder bei Punkt 1 wären.
Sorry, Frankfurt, aber: Kneipenkultur? Fehlanzeige.
Platz 3: Eine echte alternative Szene

Dies führt bereits zum dritten Platz, der mich persönlich wirklich ärgert:
So bunt auch Frankfurts Vielfalt, so kaum vorhanden auch eine alternative Szene. Freunde von lauter Gitarrenmusik, Tattoos & schwarzer Kleidung tun sich hier schwer bei der Suche nach Gleichgesinnten und Orten, an denen man auf eben diese treffen kann.
Die alternative Club-Szene beschränkt sich auf nicht weniger als zwei Tanzlokale, die da wären das “Final Destination” und das “The Cave“.
Die beiden Läden besuche ich zwar selbst sehr gerne, verglichen mit den alternativen Clubs in anderen Städten (sogar ausgerechnet Augsburg hat die “Rockfabrik”!) bieten auch diese aber ein geradezu trauriges Bild ab.
Unter der Woche herrscht tote Hose, sodass bis zum Wochenende auf alternativ angehauchte Kneipen ausgewichen werden muss.
Doch – ihr ahnt es bereits – auch dies ist in Frankfurt nicht so einfach, lassen sich diese doch an einer Hand abzählen.
Eine der bekanntesten Kneipen, die sich selbst als “alternative Musikbar” bezeichnet, besuche ich zwar selbst sehr gerne:
Das “Feinstaub” im Frankfurter Nordend.
Eine tolle Bar, aber “Musikbar”? Hello there, schon mal im “Engel” in Düsseldorf gewesen? Wo man sich aufgrund der brachial lauten Musik kaum mit seinem Gegenüber unterhalten kann?
Okay, will man dort eh nicht, denn was zählt ist dort: Musik, headbangen, abgehen, Alltag vergessen. Mag das (Alt-)Bier auch noch so ungenießbar sein.
Die Musik im Feinstaub dagegen: Bloße Hintergrundmusik. Schade.
Klar, es gibt Locations wie das “Café Exzess” oder die “Au“, welches ich allerdings eher als politisch denn alternativ betrachte. Und die legendäre Batschkapp sowie deren ehemaliges Anhängels “Elfer” haben sich längst zur reinen Veranstaltungs-Location beziehungsweise Techno-Club gewandelt.
Als Freund der alternativen, lauten Musik hat man’s leider wahrlich schwer in Frankfurt.
Ein schwacher Trost: Marburg und Darmstadt sind nicht weit.
Platz 4 : Ein fähiger Verkehrsverbund

Frankfurt am Main schmückt sich gerne damit, eine Metropole zu sein. Schön wäre es allerdings, wäre ein öffentlicher Nahverkehr vorhanden, der der Infrastruktur einer Metropole auch gerecht würde.
Verantwortlich für diesen Mangel:
Deutschlands wohl grottigster Verkehrsverbund, der Rhein-Main-Verkehrsverbund.
Dieser bestellt im Auftrag des Landes Hessen die Nahverkehrsdienstleistungen bei den unterschiedlichen Verkehrsunternehmen. Ebenso vorgegeben werden Fahrpläne, Linien und Fahrpreise.
Leider ist es dem RMV auch nach 20 Jahren seit seiner Gründung nicht gelungen, ein transparentes Preissystem zu erschaffen, welches vom durchschnittlichen Fahrgast (der doch einfach nur einen Fahrschein kaufen möchte) auch ohne abgeschlossenes Studium der Verkehrsgeographie sowie der Wirtschaftsmathematik verständlich und nachvollziehbar wäre.
Und klar, dass zum Fahrplanwechsel im letzen Dezember gleich noch eine saftige Preiserhöhung aufgetischt wurde.
Ach, wie schön das doch in anderen Städten ist: Da gibt es Ringe oder Streifen, nach einem schnellen Blick auf den Netzplan ist ersichtlich, wie viele von ihnen auf dem Weg zum Fahrtziel durchquert werden müssen – und folglich, welch Fahrpreis zu entrichten ist. Bestes Beispiel hierfür ist Berlin: Ring A, Ring B, Ring C – drei Ringe, drei Fahrpreise, fertig. Wie einfach das doch sein kann!
Die Fahrpreise indes sind im Dunstkreis des RMV obendrein happig: Auch Monatskarten sind im bundesweiten Vergleich unangefochten teuer. So kostet eine Monatskarte allein für das Stadtgebiet Frankfurt (pardon: Tarifgebiet 50) stolze knappe 90 Euro. Da ist sogar München – obwohl wesentlich größer – erheblich günstiger.
Der jüngste Versuch, das eigene Preissystem zu reformieren und endlich fair und verständlich zu gestalten, endete äußerst peinlich:
So wurde das als Revolution gefeierte Projekt “rmvSmart” noch während der Erprobungsphase für gescheitert erklärt.
Wäre ja zu verschmerzen, stünde den exorbitanten Fahrpreisen wenigstens ein entsprechendes, einer selbsternannten “Metropole” angemessenes Angebot entgegen. Ein echter Mangel besteht freilich auch an Parkplätzen, jedoch ließe sich dieser leicht beheben, würde es gelingen, mehr Menschen zur Nutzung von Bus & Bahnen zu bewegen. Dies setzte jedoch ein erschwingliches wie attraktives Angebot voraus.
Dem ist nicht aber so:
Nicht einmal am Wochenende verkehren – zumindest stündlich – S- und U-Bahnen. Erzählte man dies einem Nordrhein-Westfalen oder Berliner, dürfte man allenfalls ungläubiges Kopfschütteln ernten. Oder wahlweise schallendes Gelächter.
Aber hey, wer Samstag nachts nach ein Uhr noch nach Hause möchte, kann ja auch die restlichen Stunden der Nacht bei einer Rundreise kreuz und quer durch die Stadt im überfüllten Nachtbus verbringen. Unterhaltung durch Mitreisende garantiert!
Und wozu überhaupt eine nächtliche S-Bahn nach Offenbach oder Hanau? Da will doch eh niemand hin. Nicht freiwillig.
Platz 5: Polizeipräsenz in der Innenstadt

Die Polizei Frankfurt mag auf Facebook & Twitter überaus präsent sein. Und das nicht einmal erfolglos: Immer wieder stellen die Social Media-Beamten unter der Beweis, dass sie eine zeitgemäße wie humorvolle Kommunikation mit der Bevölkerung beherrschen. Über die Story vom von der Polizei gefundenen Poesie-Albums der kleinen Mila wurde sogar in der Berliner Zeitung berichtet.
Wo sie dagegen weniger präsent ist: An den Brennpunkten der Frankfurter Innenstadt.
So werden unweit der Polizeiwache 1 direkt an der Konstablerwache völlig ungeniert Drogen gehandelt. Man macht sich nicht einmal mehr die Mühe, zwecks Abwicklung der Geschäfte in die nächste dunkle Ecke zu verkrümeln:
Geld- wie Rauschgiftübergabe vollziehen sich am hellichten Tage gänzlich unbedarft und vor den Augen der Flaneure. Auch ich werde fast immer danach gefragt, ob ein akutes Bedürfnis nach Drogen meinerseits bestünde, wenn ich über die “Konsti” schlendere. Hab’ ich in anderen Städten so noch nie erlebt, stört mich aber nicht weiter. Die Dealer sind schließlich zumeist friedlich. Passanten mit weniger dickem Fell mögen jedoch durchaus eingeschüchtert sein. Mal ganz abgesehen davon, dass öffentlicher Drogenverkauf in Deutschland schlicht illegal ist. Warum die Polizei unter diesen längst stadtbekannten, florierenden Handel nichts unternimmt, ist bisweilen schleierhaft.
Was mich dagegen sehr stört:
Wer am Wochenende nachts über die Zeil wandert, erhält unfreiwillig einen Einblick in menschliche Abgründe. Aggressive Betrunkene, randalierende Jugendliche und pöbelnde Halbstarke sorgen auch bei mir für eine innere Alarmbereitschaft. Eine teils aggressive Bettel-Mafia hat sich auf der Zeil etabliert und nimmt denen ihre Bühne, die wirklich bedürftig sind. Auf Münzen in ihrem Hut angewiesen sind, um zu überleben.
Das selbe Bild in den unterirdischen Bahnhöfen. Hier trifft man auf das selbe Klientel oder auch Süchtige, die auf Bahnsteige urinieren oder mit Crackpfeifen und Spritzen hantieren. All das kann man nächtens hier bewundern, jedoch eines nicht: Den Anblick von Uniformierten.
Klar, soziale Probleme lassen sich nicht allein durch Polizeipräsenz lösen. Dennoch löst dessen Anwesenheit ein subjektives Sicherheitsgefühl aus, welches ein jeder Bürger verdient hat. Und insbesondere in noch größeren Städten wie Berlin oder Köln, mal ganz zu schweigen von München (in denen ich oftmals unterwegs bin!) wäre eine von den Hütern des Gesetzes vollkommen verlassene Innenstadt unvorstellbar.
So gut ihr das mit diesem Facebook auch hinbekommt, liebe Polizei Frankfurt: Traut euch doch ab und an auch mal hinter euren Bildschirmen hervor und zeigt Präsenz in der Stadt. Bürger und Ruf der Stadt werden es euch danken.
Platz 6: Konzertkultur

Frankfurt darf sich vollkommen zurecht als Geburtsort des Techno bezeichnen und bietet auch heute noch eine hervorragende Club-Szene. Auch im HipHop hat sich die Stadt früh einen Namen gemacht – ich erinnere an diese Stelle mal an das “Rödelheim Hartreim Projekt”.
Für handgemachte Musik bietet die Stadt leider wenig Platz. Insbesondere lokale Künstler haben es schwer, ihre Musik an ein Publikum zu bringen.
Die ganz großen Bands lassen Frankfurt derweil oftmals gleich ganz außen vor und bevorzugen den “Schlachthof” in Wiesbaden als Spielstätte.
Schön, dass Initiativen wie “OHRWURM” versuchen, mit Wohnzimmer-, Cafe – und Bar-Konzerten der Stadt ein wenig mehr musikalisches Leben einzuhauchen. Auch kleinen Künstlern eine Bühne zu bieten.
Klassische kleine Konzert-Locations sind derweil wenige vorhanden – seit Sinkkasten & die “alte” Batschkapp verschwunden sind, verblieben lediglich wenige davon. Hierbei seien das “Mampf” im Ostend erwähnt (Jazz), der “Dreikönigskeller” in Sachsenhausen sowie das “Spritzehaus” in Alt-Sachsenhausen.
Insbesondere im Vergleich zu Hamburg und Berlin hat Frankfurt hier echte Defizite. Doch die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt!
Platz 7: Berge, Meer & Seen

“Ich liebe die Schiffe, das Meer und den Hafen” – das sangen Fettes Brot schon vor langer Zeit. Kein Wunder, würde ich ihn Hamburg leben – ich wäre wohl ähnlich angetan.
Der Münchner wiederum weiß die Alpen quasi vor seiner Haustüre und liebt sie für das Panorama, um welches sie seinen bayrischen Horizont erweitern. Okay, außer, er beschwert sich gerade wieder einmal über den Fön.
Doch ein spontaner Wander-Ausflug in die Berge? Ein Spaziergang am Meer? Ein ganzer Sommertag am See? In Frankfurt leider nicht ohne weiteres drin.
Ein paar Hügel, ja, Flüsse gibt’s auch ein paar in der Umgebung – das wars dann aber auch.
Wen die Lust auf Berge und Meer packt, ist dies erst einmal mit einer längeren Reise verbunden. Gut, dass man hier wenigstens den größten Flughafen des Landes in der Nähe weiß – und die Welt dennoch recht schnell offen steht.
Wenn auch nicht für einen spontanen Ausflug.
Immerhin im Umkreis gibt es einige schöne Seen, welche teils sogar zum Baden genutzt werden dürfen und an denen es sich im Sommer schön fläzen und braun werden lässt. Prominentes Beispiele hierfür sind Langener Waldsee und Walldorfer See, die leider in der Hochsaison hoffnungslos überlaufen sind.
So schön die Seen auch sind, ohne Auto oder Bahn sind sie nur schwierig zu erreichen. Schade, dass im Stadtgebiet kein öffentliches Gewässer zum Baden zur Verfügung steht. Einzige Ausnahme ist der Schwedlersee, das kühle Nass ist jedoch ausschließlich den Mitgliedern des dort residierenden Schwimmclubs vorbehalten. Schade!
Platz 8: Gelassenheit der Stadtverwaltung

Kommen wir zu einem meiner absoluten persönlichen Top-Aufreger:
Die Stadt Frankfurt feiert sich nur allzu gern dafür, eine offene, urbane und lebenswerte Stadt zu sein. Lässig eben.
Leider gar nicht so lässig geben sich derweil Stadtverwaltung und Ordnungsamt, wenn es um Umsetzung und Einhaltung von Paragraphen geht. Eine öffentlich Ordnung will schließlich gewährleistet sein – gern auch mal auf Anordnung. Frankfurt liegt schließlich immer noch in Deutschland!
Drei Beispiele hierfür aus der jüngsten Zeit dürften dem Bürger noch in guter Erinnerung sein:
So entwickelte sich das von zwei jungen Kerlen übernommene Wasserhäuschen “GUDES” zum geschätzten Treffpunkt für die Nachbarschaft im Nordend.
Der angrenzende Matthias Beltz-Platz wurde als Open Air-Wohnzimmer genutzt, sogar Tische und Stühle wurden von den Besuchern aufgestellt und erfreuten sich großer Beliebtheit.
Dies alles ging der Stadt – die urbane Entwicklungen vordergründig begrüßt – dann doch zu weit. Zuerst wurde dem Wasserhäuschen mangels Ausschankgenehmigung untersagt, die verkauften Getränkeflaschen zu öffnen.
Dann schickte man sich gleich mehrfach an, die auf dem Matthias Beltz-Platz aufgestellten Möbel als wilden Sperrmüll zu entsorgen.
Erst nach lautstarkem Protest der Nutzer des Platzes und langen Diskussionen auf politischer Ebene erbarmte sich die Stadt, 40 einheitliche Klappstühle zu finanzieren und dort aufzustellen. Behördlich genehmigt, versteht sich.
Ähnliches Ungemacht ereilte auch den Kiosk “Yok Yok” im Bahnhofsviertel, das von der Stadt ach so gern für seine Lebendigkeit gepriesen wird.
Ausgerechnet Letztere war dem Ordnungsamt dann doch ein Dorn im Auge:
Es untersagte kurzerhand den Verkauf von alkoholischen Getränken nach 22 Uhr. Inhaber Nazim Alemdar hat gemäß´Verfügung außerdem dafür zu sorgen, dass sich vor dem Kiosk nach 22 Uhr keine Menschen mehr aufhalten und ihre Getränke dort verzehren.
Konsequenz des Ganzen: Die Menschen “verzehren” ihre Getränke jetzt 5 Meter nebenan, außerhalb des “Einwirkbereichs seiner Gastsätte”. Jawollja, Ordnung muss sein!
Über den dritten Fall wurde gar überregional berichtet:
Der Obdachlose Reiner Schaad, bekannt als “Eisenbahn Reiner”, gehörte seit Jahren zum Stadtbild. Die Frankfurter kennen und mögen ihn, grüßen ihn, wenn er allmorgendlich seine Spielzeugeisenbahn an seinem Stammplatz in der Liebfrauenstraße aufbaut. Hey, hat echt niemanden gestört. Nun ja – fast niemanden.
Kein geringerer als der Mönch “Bruder Paulus” reichte nämlich Beschwerde über diesen in seinen Augen wohl untragbaren Zustand ein. Genau, ich weiß schon, warum ich Heiligkeiten wie Scheinheiligkeiten nicht mag. Das Ordnungsamt reagierte – und konfiszierte Reiners Eisenbahn und untersagte ihm den künftigen Aufbau seines Lagers. Könnte ja schließlich jeder kommen. Ferner liege dem Obdachlosen keine “Sondernutzungsgenehmigung für öffentlichen Raum” vor – die er blöderweise ohne festen Wohnsitz niemals hätte beantragen können.
Nach einer großen Welle der Solidarität und zahlreichen, öffentlich wirksamen Protestaktionen, knickte die Stadt dann persönlich ein – nachdem sich Oberbürgermeister Feldmann persönlich zu einer Reaktion gezwungen sah.
Nach mehreren Wochen des Kampfes dann knickte der Verkehrsdezernent Klaus Oesterling ein und sprach “Eisenbahn-Reiner” ein Sondernutzungsrecht samt Ausnahmegenehmigung zu. Wohl, um weiteren Schaden des Ansehens der Stadt abzuwenden. Reiner indes ist derweil die Lust an seiner Eisenbahn vergangen – er möchte doch eigentlich nur seine Ruhe haben wollen.
Liebe Stadtverwaltung, liebes Ordnungsamt:
Auch ohne, dass ihr es gerne propagiert – unsere Bürger SIND offen und pflegen ein entspanntes Miteinander. Hört endlich auf, dies mit eurer Engstirnigkeit zu gefährden und torpedieren! Danke.
Platz 9: Ein gutes Image

Nach Berlin wollen sie ohnehin alle. “Kraftklub” vielleicht mal außen vor. München gilt gemeinhin als die “Perle des Südens”, jeder schwärmt vom dortigen Bier, der Gemütlichkeit der weltbekannten Biergärten.
Ich habe noch nie jemanden getroffen, der von einem Besuch in Hamburg zurückgekehrt wäre, und nicht von der Stadt geschwärmt hätte. Köln, das ist Karneval und rheinländische Heiterkeit, der Besucher Dresdens verliebt sich augenblicklich in die schöne Altstadt.
Heidelberg, ja, die quirlige Studentenstadt – oft bereist sogar von Asiaten und Amerikanern – mag auch irgendwie jeder, Freiburg wird ebenso schnell ins Herz geschlossen. Ebenso wie Nürnberg, das nicht nur zum Zeitpunkt des Christkindlmarktes gern besucht wird. Soll ja schließlich auch ziemlich gutes Bier dort geben.
Und was ist eigentlich mit Frankfurt?
Frankfurt gilt vielen nach wie vor als ein großes Moloch.
Wie oft schon bekam ich zu hören, Frankfurt sei eine schmutzige, kalte Stadt voller Elend und Bänkern – insbesondere von Leuten, die “mal zu einer Messe” hier waren oder deren Frankfurt-Besuch ausschließlich zwischen Haupt- und Konstablerwache stattfand.
Ich bekomme dann stets das akute Bedürfnis, meine Heimat zu verteidigen.
Und sehe nicht ein, dass Frankfurt im Beliebtheits-Ranking deutscher Städte immer noch irgendwo zwischen Dessau und Castrop-Rauxel rangiert.
Doch, auch ich muss eingestehen, Frankfurt hat sich nicht mit Ruhm bekleckert, was die Stadtentwicklung in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts betrifft. Insbesondere sozial- und verkehrspolitisch wurden zahlreiche Fehlentscheidungen getroffen, vom schon grotesk-hässlichen Wiederaufbau der im Krieg zerstörten Innenstadt einmal ganz zu schweigen.
Erschwerend kommt hinzu: Jede Großstadt hat ihre Schandflecken und Brennpunkte. Blöderweise liegt der wohl jahrzehntelang größte davon direkt an dem Ort, den der gemeine Frankfurt-Besucher meist als erstes zu Gesicht bekommt: Dem Hauptbahnhof.
Kann ich es also jemandem verübeln, der – frisch in Frankfurt angekommen – den Hauptbahnhof verlässt und sich augenblicklich die Frage stellt:
” Um Himmels Willen . das hier soll also Frankfurt sein? Wann fährt der nächste Zug, der mich schnell wieder weg bringt von hier? “
Irgendwie nicht. Und das finde ich so schade!
Frankfurt, du hast viel Mist gebaut in den letzten Jahrzehnten. Dir deinen Ruf als Verbrechens- und Betonhauptstadt hart erarbeitet. Wird Zeit, dass du dich mächtig ins Zeug legst – um einen Ruf zu erhalten, der dir als so lebenswerte, bunte und auch schöne Stadt gerecht wird. Meinen eigenen Beitrag hierfür steuere ich gern bei!
Platz 10: Waschechte Frankfurter

Läuft man durch die Straßen Münchens, so sind all diejenigen, die ihr gesamtes bisheriges Leben an der Isar verbracht haben, schnell und zahlreich auszumachen. Mit unverkennbarem Dialekt und einer herzlichen “Grantligkeit” sind die Münchner Kindl, wie sie sich selbst so gern bezeichnen, schnell auszumachen.
In der Hauptstadt ist der waschechte Berliner ebenso schnell auszumachen.
“Klar, dit ick von hier bin!”, fragt er, und schimpft über all die Touristen und Zugezogenen.
Im Ruhrpott ist der Durchschnitts-Westfale ebenso stolz auf Heimat und längst vergangene Zeiten, als im Pott noch rauchende Schornsteine Deutschlands Wohlstand sicherten.
So erfüllen eigentlich allerorts im Lande die Einwohner viele der Klischees, die man ihnen so nachsagt.
Doch was ist mit Frankfurt? Wo sind sie denn, all die Frankfurter Originale?
Hand aufs Herz:
Wann habt ihr zuletzt einen waschechten Frankfurter kennen gelernt?
Diejenigen, die Apfelwein schon mit der Muttermilch aufgesogen haben, bereits ihre Kindheit hier verbracht haben – und auch aufgrund ihrer Redensart sofort als “Frankfodder” auszumachen sind?
Die der Eintracht die Treue schwören und selbstverständlich alljährlich über Pfingsten Urlaub nehmen, um im Stadtwald tagelang den “Wäldchestag” zu zelebrieren?
Mir passiert das wirklich selten. Schade eigentlich, verleihen doch gerade die schon immer Hier-Gewesenen ihrer Stadt einen unverwechselbaren Charakter.
Mag wohl daran liegen, dass viele Menschen allein aus beruflichen Gründen in der Mainmetropole landen. Die Fluktuation hoch, die Verweildauer begrenzt ist.
Und vielleicht auch daran, dass “Frankfurter sein” mehr ein Gefühl der Zugehörigkeit als eine Frage der Herkunft ist.
Trotzdem fordere ich all die Menschen, welche Frankfurt am Main als ihren Geburtsort im Personalausweis eingetragen haben, dazu auf:
Egal, wo auch immer ihr euch verstecken mögt:
Verlasst öfters mal eure Wohnungen in Unterliederbach, Sindlingen, Zeilsheim, Hausen, Harheim oder Ginnheim – und mischt euch unter all die Zugezogenen!
Schließlich seid ihr eine echte Bereicherung für diese Stadt!
Insbesondere in den innerstädtischen Stadtteilen lässt es sich bislang zwar vorzüglich über die Heimat des Gegenübers unterhalten – aber ein paar Anekdoten von früher, ein paar Worte gepflegter Frankfurter Mundart, ein bisschen mehr Frankfurt dem Stadtleben: Ja, das wäre schön. Eine Bereicherung, mir eine große Freude. Traut euch!
Aber sonst…
Ja, aber sonst hat Frankfurt so ziemlich alles, was eine lebens- wie liebenswerte Großstadt auszeichnet. Und nirgends dürfte eine größere kulturelle, architektonische wie landschaftliche Vielfalt auf ähnlich kleinem Raum bestehen.

Frankfurt – das ist oftmals Liebe erst auf den zweiten Blick. Doch wer sich einmal von der Stadt in ihren Bann hat ziehen lassen, der mag hier nicht mehr weg.
Und sagt man nicht gerade den Frankfurtern nach, sie seien nur glücklich, wenn sie ordentlich was zu meckern haben?
Mir jedenfalls gehts nun schon deutlich besser.
Und in einer perfekten Stadt zu leben – das wär’ ja auch irgendwie langweilig, oder?