Hat eigentlich irgendjemand einmal irgendwann behauptet, das ziellose Umherflanieren sei nichts weiter als Zeitverschwendung? Einer solchen Thesis kann und möchte ich in meiner Funktion als gestandener und leidenschaftlicher Flaneur an dieser Stelle nachdrücklich widersprechen. Belege, gefällig?
Es begab sich vor einigen Tagen, dass ich über die Berger Straße wandelte. Dort gibt’s für den gemeinen Frankfurter nämlich immer etwas zu gucken und entdecken. Vorausgesetzt natürlich, er setzt erst einmal seine großstädtischen Scheuklappen ab und hält die Äuglein nur ein wenig offen! So sollte auch ich recht bald eine Entdeckung gemacht haben: Kaum den Merianplatz passiert, lenkte ein farbenfroher Pavillon meine Aufmerksamkeit auf sich. Der passionierte Flaneur weiß natürlich, dass in solchen Momenten gilt: Innehalten, gucken, Hallo sagen!
Von der Poesie und den psychischen Wehwechen
Nur wenig später sollte sich der Pavillon als Info-Stand entpuppt haben. Was ich nämlich noch nicht wusste: In jener Woche fand Psychiatrische Woche Frankfurt , statt, eine Veranstaltungsreihe die Menschen mit psychischen Problemen auf die zahlreichen Hilfs- und Beratungsangebote will. An dieser beteiligte sich auch die Selbsthilfe Frankfurt e.V., deren freundlichen Mitarbeiterinnen mir am Stand begegneten.
Nicht,dass ich akut hilfsbedürftig gewesen war, in jenem Moment kam ich auf mein Leben halbwegs klar. Doch war auch ich schon durch schlimmere Zeiten gegangen. Noch heute bin ich den Menschen dankbar, die mich damals aus meinem Loch gezogen hatten.
Anlass genug, um in Richtung der Veranstalter zu sagen:
Hey, wiie schön, dass es euch gibt! Wie schön, dass ihr einer noch immer viel zu oft tabuisierten Thematik einen Platz im öffentlichen Raum verschafft! Fantastisch, dass ihr mit der “Träumerliga” anlässlich der “Psychiatrischen Woche” unter Beweis stellt, dass sich Prosa, Lyrik und Musik sich ganz vorzüglich mit den kleinen und großen Wehwehchen unserer Seelen vereinbaren lassen!
Dass ich zwei Tage später also in einem schattigen Hinterhof sitzen und mich auf einen vom Offenbacher Poeten Finn Holitzka moderierten Nachmittag der musikalischen und lyrischen Unterhaltung freuen durfte, hatte ich folglich allein dem Glück des wachsamen Flaneurs zu verdanken.
 Wirkt souverän wie ein alter Hase: Moderator Finn Holitzka
Wirkt souverän wie ein alter Hase: Moderator Finn Holitzka
Eine ebenso glückliche Fügung (die eigentlich eine unglückliche war, schließlich steckte eine der Künstlerinnen im Zug fest…) war es auch, die mich spontan einspringen und einen meiner Texte vor dem Publikum zum Besten geben ließ. Zwar schwor ich mir umgehend, niemals wieder gänzlich unvorbereitet eine Bühne zu betreten – aber hey, das hier war doch für den guten Zweck!
Ein Problem zu haben ist kein Zeichen der Schwäche, das kann man gar nicht oft genug betonen. Schwach ist allein derjenige, den allein der Stolz daran hindert, sich helfen zu lassen.
Noch auf dem Heimweg erinnerte ich mich an eine Kurzgeschichte, die ich einmal schrieb. Eine Geschichte über den überwundenen Stolz, über das Suchen und Finden von Hilfe, über Geschehnisse im Wartezimmer. Über Patienten mit mancherlei Macken, die sie vor allem zum einem werden lässt: Den liebenswürdigsten Menschen dieser Welt. Dachschaden hin, Dachschaden her….
Habt ihr Bock drauf? Dann folgt mir auf meinem Weg zur Praxis des Dr.H !
Crazy Typ
Nie hätte ich gedacht, dass ich einen solch merkwürdigen Ort gleich einen Stadtteil weiter finden würde. Aber sagte man nicht immer, das Abenteuer lauerte an jeder Ecke? Ich musste nicht erst in ferne Kontinente reisen, um jenen Ort zu finden, und auch Lonelyplanet konnte ich links liegen lassen (warum lässt man Dinge eigentlich niemals rechts liegen? Eine Frage, deren Beantwortung ich dem Leser überlasse…), musste nicht vollkommen unvorbereitet mein Handgepäck dann doch auf dem Rollfeld abgeben und in den Frachtraum des Billigfliegers laden lassen. Musste mir nicht einmal die Sitze des kleinen ICE-Abteils mit einer neunköpfigen Großfamilie und den Gerüchen ihrer in Tupperware düpierten Apfelstücke und Käsebrote teilen. Nein, nicht einmal Kosten waren mir entstanden. Alles, was ich brauchte, war ein Stück Papier: Ein rosafarbener Vordruck war meine Eintrittskarte, denn meinen Ausflug sollte die Kasse zahlen. Kryptische Zeilen, vom Nadeldrucker surrend ausgespuckt, wiesen mir den Weg. Das Einzige, was ich selbst aufbringen musste, war Geduld. Ja, die Wartezeiten auf einen Facharzttermin sind mitunter lang.
Doch gehen auch dreizehn Wochen irgendwann einmal vorüber, und an einem Nachmittag im Spätsommer hatte ich mein Ziel erreicht: Einen so unscheinbaren wie auch schmucklosen Nachkriegsbau im Frankfurter Osten. Hier war ich richtig. Ein Blick auf das Klingelschild hatte auch die letzten Zweifel beiseite geräumt. In behördlicher Präzision war darauf in Schreibmaschinenlettern eingemeißelt: „PRAXIS DR. H.“.
Eine Aufschrift, die selbst schon Diagnose war. Dachte der Psychiater etwa tatsächlich, der dezente Schriftzug „PRAXIS DR. H“ wirke auch nur im Ansatz unverdächtig, ließe den Betrachter eher auf einen Fachmann für Fußreflexzonenmassage denn auf einen niedergelassenen Nervenarzt schließen? Wie auch immer: Wer hier klingelte, der hatte es geschafft. Oder, besser: Nicht geschafft. War nicht mehr ganz knusper im Kopf, kam auf sein Leben nicht mehr ganz so klar, leistete der eigenen mentalen Verfassung den Offenbarungseid. Hier landeten die Unverstandenen, die von sich selbst und der Gesellschaft Überforderten. Die fahrlässig Ausgegrenzten, diejenigen, vor denen Mütter schon immer gewarnt hatten. Menschen wie ich.
Ein letzter Moment des Zögerns, bevor ich auf die Klingel drückte. Ein kurzes Summen, ich betrat das kalte Treppenhaus. Noch auf dem Weg in den zweiten Stock, wo DR. H. praktizierte, entwich jegliche Souveränität durch meine Poren. Dies hier würde eine heikle Mission werden. Dass ich kurz zuvor schon keinen adäquaten Parkplatz für mein Fahrrad hatte finden können, begriff ich dabei als düsteren Vorboten. Ich hatte es zwei Blocks weiter anschließen müssen, denn schon der Innenhof der Praxis des Dr. H. hatte ganz offensichtlich nicht mehr alle Latten am Zaun.
„Ihre Gesundheitskarte, bitte!“ – Ein kurzer Moment der Erleichterung. Bis hierhin lief also alles normal, nur dass sich die Stimme der freundlichen medizinischen Fachangestellten – Sprechstundenhilfe darf man ja nicht mehr sagen – ein wenig mehr nach einer Schachtel Marlboro am Tag anhörte denn üblich. Auch die Gemälde irgendwelcher Ostseelandschaften sahen genau aus wie diejenigen, die ich bereits von Augen-, Haut- und Hausarztpraxen kannte. „Nehmen Sie doch noch kurz im Wartezimmer Platz!“ – wenige Worte genügten, um meiner kurzzeitigen Entspannung den Garaus zu machen. Shit. Darauf war ich nicht vorbereitet, dabei hätte ich es ahnen müssen. Geplagt von Selbstvorwürfen dachte ich nach.
Wie verhielt man sich als Neuankömmling im Wartezimmer einer psychiatrischen Praxis? Galten dort andere, hirnverbrannte Regeln? Sollte ich in bester Manier stillschweigend zur Apotheken-Umschau greifen und so tun, als würde ich deren Kreuzworträtsel lösen? “Idiot mir drei Buchstaben: ICH“ ? Die anderen Patienten keines Blickes würdigen? Oder aber wurde hier, unter Meinesgleichen, von Neuankömmlingen ein wenig mehr der Offenbarung erwartet denn das obligatorische knappe Nicken, gefolgt von einem dahingenuschelten „Guten Tag“ ? Welchen kläglichen Rest an Diskretion galt es hier schon zu verlieren? Und, diese Frage drängte sich mir geradezu auf, wie würde ich eigentlich reagieren, blickte ich hinter der noch verschlossenen Tür in die Gesichter eines Nachbarn, eines Kollegen, des der lieben Kassiererin von Penny? Nachdem ich gedanklich verschiedene Szenarien durchgespielt hatte, entschied ich mich für den Frontalangriff – und drückte die Klinke hinunter.
„Guuuuuude, ihr Leut‘!“, brüllte ich in den Raum hinein, noch ehe ich mich umgesehen hatte. „Ich bin der Matze und ein, nun ja, echt crazy Typ!“. Noch während ich die Sitzreihen auf einen freien Platz absuchte, bemerkte ich die fehlende Deutlichkeit meiner Worte. Als „crazy Typ“ bezeichnete sich heutzutage schließlich schon ein jeder Mittelständler, wenn er sein Knoppers statt um halb zehn erst `ne halbe Stunde später zu verputzen pflegte. Ich präzisierte also meine Aussage: „Also, crazy im Sinne von ein bisschen balla balla, von ein bisschen Matsch in der Birne, bisschen neben der Spur eben. ICH BIN EINER VON EUCH!“ Ich hielt meine ausgestreckten Handflächen vors Gesicht und simulierte einen Scheibenwischer. Das, dachte ich, sollte deutlich genug gewesen sein.
Nach einem kurzen, peinlichen Moment der Stille erhob sich ein muskulöser Typ und sprang geradewegs auf mich zu. Zu meiner Überraschung ballerte er mir nicht ohne Vorwarnung gleich eine rein, sondern eröffnete, so schien es mir, geradezu erfreut ein kleines Gespräch unter Gestörten. „Crazy Typ, wie geil ist das denn! Crazy Typ, Alter, du bist ja wirklich gaga!“ Er formte eine Ghetto-Faust, in die ich geringfügig verstört einschlug. „Crazy Typ, ich raste aus! Nicer Shit!“, tatsächlich schien ihn mein Auftauchen zu erfreuen. Er schüttelte den Kopf und tänzelte zurück zu seinem Platz. Eine gute Gelegenheit für mich, einen Blick in die illustre Wartezimmerrunde zu werfen. „Guten Tag“, presste der Mann am Fenster hervor. Nur ganz kurz fragte ich mich, warum er im spärlichen Licht des Zimmers seine Augen hinter einer Sonnenbrille verbarg. Auch, warum er im Sommer eine Jacke trug, erschloss sich mir zunächst nicht ganz. „Äh ja, schön, hier zu sein“ schloss ich meine Ansprache und setzte mich auf den freien Platz, dem Ghetto-Faust-Typen gegenüber. Dabei gab der Ärztezimmerwartestuhl ein leises Quietschen von sich – da war wohl eine Schraube locker. Abermals kehrte Stille ein. Zumindest solange, bis mein Gegenüber mit nervösen Fingern seine Kopfhörer in seine Gehörgänge gepfriemelt hatte. Nun fluteten dröhnende Bässe den Raum. Die Lippen meines Ghettofaust-Freundes bewegten sich zur Musik, er begann, unaufhörlich mit den Beinen zu wackeln. Statt ihn zu kauen, schien er seinen Kaugummi zu beißen. Ich tippte auf manisch-depressiv. Welche Phase er durchlebte, muss ich an dieser Stelle wohl nicht eigens erwähnen.
Probleme ganz anderer Art schien dagegen seine Sitznachbarin zu haben. Ihr BMI war augenscheinlich minus zwölf, und ein Blick das Titelblatt der Illustrierten, in der sie blätterte, bekräftigte meinen Verdacht: „Blitz-Diät: So verlieren Sie 10 Kilo in nur einer Woche“. Das Mädchen tat mir leid. Am liebsten hätte ich den Pizzalieferdienst direkt ins Wartezimmer bestellt, hätte sie anschließend auf einen Eisbecher eingeladen, von mir aus auch auf fünf. Ich wusste, dass das nichts helfen würde. Anorexie war eine miese Bitch. Ich hoffte, das schmale Mädchen würde bei Dr. H. In guten Händen sein, wenn schon der Pizzabote es nicht mehr richten konnte. Mit scheuem Blick sah sie von ihrer Zeitschrift auf. Ihre Augen waren leer.
Unangenehm berührt sah ich mich weiter um. Ich gebe zu, ich fühlte mich erleichtert: Dieser Raum sah mitnichten aus wie das Vorzimmer zur Synapsenhölle, auch starrte niemand mit wirrem Psychopathenblick umher. Niemand biss einer mitgebrachten Barbie den Kopf ab, niemand lachte diabolisch, während er ein blutverschmiertes Messer in seinen Händen wog. Nein, ich befand mich hier nicht unter Monstern. Ich befand mich unter Menschen. Das zu wissen, tat mir gut. Welche Diagnose mich im Behandlungszimmer wohl erwarten würde?
Tonlos lief auf einem Beistelltisch ein kleiner Flachbildfernseher. Das Programm flackerte; ich vermutete einen Sprung in der Schüssel. Doch was war das dort unter dem Tisch? Konnte das wirklich sein? Ich rieb mir die Augen, doch tatsächlich: Zusammengekauert lag dort eine Frau mittleren Alters, sie hatte sich gegen die Wand gepresst und ihr Gesicht unter einem Pullover verborgen. Wenn ich ganz genau hinsah, erkannte ich, wie sich ihr Brustkorb hub. Immerhin, sie atmete. „Ganz klarer Fall“, hörte ich mich denken. „Generalisierte Angststörung“. Auch sie wünschte ich bei Dr. H. in guten Händen.
Das Geräusch der sich öffnenden Tür riss mich aus meinen Genesungswünschen. Ein hochgewachsener Bursche in den späten Zwanzigern trat ein. Nachdem er sich zum zwölften Mal versichert hatte, die Tür auch wieder ordnungsgemäß verschlossen zu haben, kam er mir mit meiner Diagnose zuvor. „Sorry“, sprach er und guckte drein wie ein kleiner Junge, der sein Bäuerchen ein wenig zu früh verrichtet hatte. „Kontrollzwang“. Sprach’s und nahm neben einer weiteren jungen Frau mit feuerrotem Haar Platz, welche sich gerade im Inbegriff befand, eine Gummibärchentüte aus ihrer Handtasche zu fischen. Gerade, als sie sich die erste Ladung der pappigen Tierchen in den Mund geschoben hatte, öffnete sich erneut die Türe. „Herr Stadler, bitte!“. Keine Reaktion. „HERR STADLER, BITTE!“. Erst jetzt schaute der höchstwahrscheinlich Manisch-Depressive auf, zog sich erschrocken die Kopfhörer aus den Ohren. „Schon dran oder was?!“, er schien sich geradezu zu freuen auf seinen Termin bei Dr.H. Er verabschiedete sich von jedem einzelnen der Wartenden mit High Fives. „Immer schön meschugge bleiben!“. Allein die Soziophobikerin unter dem Beistelltisch klatschte er nicht ab.
Noch im Gehen prallte er mit einem gepflegten Mittvierziger zusammen. Mit seinem Maßanzug und seiner Designerbrille hielt ich ihn zunächst für Dr.H., doch auch er nahm auf einem der Stühle Platz und öffnete seinen Aktenkoffer. Nur wenig später flitzten seine Finger über das Notebook auf seinen Knien, während er zeitgleich ein Telefonat führte, in welchem er ohne Unterlass irgendwelche Fonds erwähnte. Dabei irrten seiner Augen im Scannerblick über Artikel in der Financial Times, die er zwischen Tastatur und Oberbauch ausgebreitet hatte. Auch hier war der Fall ganz klar: Burnout, vermutlich im Endstadium. Kurz überlegte ich, ihm meine Playstation auszuleihen. Auch überlegte ich, selbst eine Karriere als Psychiater anzustreben: Das Stellen von Diagnosen durch bloßes Beobachten hatte begonnen, mir Spaß zu machen.
Die junge Frau mit dem roten Schopf war zwischenzeitlich von Gummibärchen auf Schokoriegel umgestiegen; es raschelte, als sie den mittlerweile beträchtlichen Verpackungsberg vor sich um eine SNICKERS-Folie wachsen ließ. Noch wurde ich nicht recht schlau aus ihr. Genüsslich begann sie zu kauen, die Zeitschriftenleserin schaute mit einer seltenen Mischung von Sehnsucht und Ekel zu. Auch der Mann im Fenster blieb mir weiterhin ein Rätsel; abgesehen von seiner Sonnenbrille sah er aus wie jemand, dessen Geist nur so in sich ruhte.
Ich warf einen Blick auf meine Armbanduhr. Wie lange ich wohl noch hier sitzen bleiben musste? Als ich aufsah, war Mr. Kontrollzwang damit beschäftigt, die Sitzfläche seines Stuhls mit Desinfektionsspray in kreisender Weise zu bearbeiten. Vielleicht, dachte ich, sollte ich ihn einmal zu mir nach Hause einladen, so ganz selbstlos. Ich grinste in mich hinein. Das gertenschlanke Mädchen war an der Reihe und verabschiedete sich mit einem bösen Blick von der Rothaarigen, die sich gerade über eine Tafel Schokolade und ein Stück mitgebrachten Kuchen hermachte. Herr Burnout indes telefonierte immer noch, ich spürte Tropfen auf meiner Stirn. Ich starrte hinauf zur Decke. War etwa ein Dachschaden aufgetreten? Dem kurzen Geschmackstest folgte die Erleichterung: Allein Schweiß war es, der meine Stirn bedeckte. Kein Wunder, bedachte man, dass ich in Bälde erstmals mein Oberstübchen mustern lassen würde. Mr. Kontrollzwang besprühte statt seiner Sitzfläche nunmehr großflächig seine Arme. Unsere Blicke streiften sich. „Kann ich nix für“, sagte er entschuldigend. „Ich bin nicht mehr ganz sauber.“
Nun schien auch der Mann in Sonnenbrille zu erwachen. „Da hilft nur Hochprozentiges!“, rief er hinüber, während er einen Flachmann aus der Innenseite seiner Jacke zog. „Auch `n Schluck“? Mr. Kontrollzwang lehnte dankend ab; er schwöre weiterhin auf Sagrotan. Da hatten wir es also: Suchtprobleme. Das, musste ich mir eingestehen, war auch ein vertrackter Fall gewesen. Sucht war nun mal selten offensichtlich, und fast war ich froh, dass sich der Sonnenbrillenträger Hilfe bei Dr. H. Suchen würde. Gerade noch rechtzeitig hatte er den Schnaps wieder in der Jackentasche versteckt, als er von der verrauchten Stimme aufgerufen würde. Er verzog den Mund, im Vorbeigehen zwinkerte er mir zu. Lange konnte es nun auch für mich nicht mehr dauern.
Auch ich würde all den Menschen in diesem Raum zuzwinkern, wenn ich ihnen einmal über den Weg liefe. Irgendwo da draußen, irgendwo in meiner Stadt. Psychisch krank, was hieß das schon? Dr. H.`s Patienten mochten sich zwar in ihrer Gedankenwelt ein wenig abseits der Norm bewegen, auf ihre ganz spezielle Weise. Doch hatten sie alle jenen Punkt erkannt, an dem sie ihrem Glück nur selbst im Wege standen. Vor allem aber hatten sie Eier, von mir aus auch Eierstöcke: Sie brachten den Mut auf, sich helfen zu lassen. Selbst, wenn das bedeutete, sich auf den Weg zu Dr. H. Zu machen. Selbst, wenn das bedeutete, erst einmal Platz in einem Raum wie diesem zu nehmen. Wer hier saß, war über einen Schatten gesprungen. Wie viele der aalglatten, ewiggrinsenden und Facebook-Timelines mit glücklichen Urlaubsbildern überflutenden, beruflich immer und ausschließlich erfolgreichen, marathonlaufenden Hochglanzvisagen da draußen hätten diesen nicht? Einmal abgesehen davon, dass sich auch bei all den Vorzeigemenschen in unseren Straßen hinter ihren geleckten Fassaden wohl manches Übel verbarg. Waren die wahren Depressiven nicht ohnehin diejenigen, die nichts taten als zu arbeiten und ihre freie Zeit mit Netflix und Spiegel Online auf dem Sofa vergeudeten, um sich vom Büroalltag zu erholen? Die all ihre Träume ihren austauschbaren Karrieren geopfert hatten, die zwischen Flipcharts und Konsum ganz vergessen hatten, was es hieß zu – leben?
In diesem Raum aber verleugnete sich niemand, nur damit der Instagram-Kanal keinen Kratzer bekam. Sie waren aufrichtig, wo es am wehsten tat: Sich selbst gegenüber. Hey, was war das eigentlich für `ne verkackte Gesellschaft, die Menschen wie diese hier als „Psychos“ abstrafte, statt ihrem Mut Tribut zu zollen? Warum, fragte ich mich, wurde diese Form der Aufrichtigkeit dort draußen nicht wertgeschätzt? Nein lieber war auch ich obenrum nicht mehr ganz so taccobello, statt ein sich selbst belügender, aktenkoffertragender Hüllenmensch mit Reihenhaus und Schäferhund. Ich fühlte, wie sich eine diffuse Wut von meiner Magengegend aus in mir breitmachte. Niemand vermochte zu wissen, welche Schicksalsschläge meine Mitpatienten hatten ertragen müssen. Niemand konnte wissen, welche Verluste sie erlitten hatten, welche Krisen sie durchlebten. Niemand hatte das Recht, sich über sie zu stellen. Basta, aus, Ende. Ich lächelte, hoffte, meine Wut würde durch meine Mundwinkel entweichen. Hatte ich mir nur eingebildet, dass in diesem Moment sogar Mr. Burnout eine circa zweisekündige Tipppause eingelegt und mein Lächeln erwidert hatte?
Anstelle des Klackerns der Tastatur konnte ich während dieser beiden Sekunden ein herzhaftes Seufzen vernehmen. Ein Blick nach links ließ mich dessen Urheber schnell ausmachen: Die Rothaarige hatte gerade ihren Löffel in eine Literpackung Eiscreme sinken lassen, seufzte erneut und schickte sich an, den Raum zu verlassen. Ihre Handtasche und den mittlerweile weiter angewachsenen Verpackungsberg ließ sie zurück. Als sie eine knappe halbe Stunde später zurückkam, schien sie seltsam befreit. Just, als sie wieder Platz genommen hatte, fiel es mir wie Schuppen von den Augen: Bulimie nervosa, noch so eine miese Bitch. Da hätte ich drauf kommen können. Bis zur Eröffnung einer Praxis Dr.G. galt es anscheinend noch einige Hürden zu überwinden. „Kann ich mal dein Desinfektionsspray haben?“, fragt sie Mr. Kontrollzwang. „Da ging wohl ein bisschen was daneben.“ Er lächelte wissend, wirft ihr die Sagrotan-Dose hinüber. „Boah das wär‘ ja nix für mich“, sagt er in ihre Richtung. Lieber verzweifle er an Türklinken. Beide fingen an zu lachen. Ich hätte sie knutschen können.
Doch dazu sollte es nicht mehr kommen. Zwanzig Minuten später hatte auch mein Stündlein geschlagen, geteerte Stimmbänder riefen meinen Namen. „Bis bald“, verabschiedete ich mich von meiner Schicksalsgemeinschaft. Ich tat es dem Sonnenbrillenträger gleich und zwinkerte. „Also, hoffentlich, also… egal. Passt auf euch auf!“ Meine Worte wurden nicht erwidert. Dieser Umstand mochte unter anderem darin begründet sein, dass Mr. Burnout sich über drei Stühle hinweg hingelegt hatte, seine Wangen an den Bildschirm seines Laptops presste und leise vor sich hin wimmerte. Zum anderen, dass die Süßigkeite-Liebhaberin ihren Sitzplatz gegen den Schoß des Sagrotan-Fans eingetauscht hatte. Ihre Gesichter ineinander vergraben, hielten sie es wie Bacardi: Sie machten Rum. War es möglich, dass sich die Patienten allesamt allein nach Liebe sehnten? Auch auf die arme Dame mit Sozialphobie, die noch immer zusammengekauert unter dem Beistelltisch lag, warf ich einen letzten Blick. Hatte man sie etwa vergessen? Ich zuckte mit den Achseln. Alles würde seine Richtigkeit haben. Wenn nicht in der Praxis des Dr.H. – ja, wo dann?
Nur wenig später saß ich jenem ganz leibhaftig gegenüber. Noch immer schmerzte sein Händedruck in meinen Fingern. „Nun erzählen Sie mal!“, munterte er mich auf und lehnte sich behäbig in seinem Psychiatersessel zurück. Neunzig Minuten später – ich hatte ihn zwischenzeitlich nur ganz wenige Male am Arm rütteln müssen, um ihn aufzuwecken! – hatte ich meine Leidensgeschichte erzählt. Der Blick des Seelen-Balsamierers bohrte sich in meine Augen. Ich fühlte mich nackt. Fühlte, dass DR.H nun Bescheid wusste. Wenn ich mich selbst schon nicht mehr verstand, dann tat das fortan DR.H. für mich.
„Mein lieber Herr“, sprach mein Messias. „Sie wollen sicher wissen, was mit Ihnen los ist.“ Ich nickte stumm.
„Sie verfügen über eine lebhafte Phantasie“, beschied mir der Bringer meines Seelenheils. Ich war verdutzt. Seit wann verteilten Mediziner Komplimente? Selbst mein Zahnarzt hatte doch ständig was zu meckern. „Um nicht zu sagen“, fuhr er fort, „eine krankhafte.“ Zack, aus, das saß. Das war also die Diagnose. „In Ihrer Wahrnehmung geht die Fiktion nahtlos in die Wirklichkeit über.“ Das war harter Tobak. „Und jetzt machen Sie mal wieder Ihren Mund zu.“ Ich gehorchte. Würde ich je geheilt werden können? Was konnte ich gegen mein Leiden tun?„Schreiben Sie auf, was Sie erleben“, riet mir Dr.H. „Das kann Ihnen dabei helfen, Ihre Einbildungen von der Wirklichkeit zu trennen.“ Erst, wenn allein das nicht helfe, sollte ich zu Tabletten greifen. Er würde mir da mal was aufschreiben. „Sicher ist sicher“, er lächelte ein Medizinerlächeln. „Und nun: Gute Besserung!“
Ungläubig und rückwärts verließ ich sein Behandlungszimmer. Das Rezept für das Medikament, dessen Namen ich nicht aussprechen konnte, steckte ich gefaltet in meine Hosentasche. Noch immer benommen von den Worten des Mediziners, stolperte ich und streifte eine Schulter. Reflexartig drehte ich mich um. Mein Atem stockte. Auch mein Vorgesetzter schien erschrocken. Nur mit Mühe gelang es ihm, meinen Namen nicht laut auszurufen. Während des mikroskopischen Moments, in dem wir uns in die Augen sahen, hatten wir einen Pakt geschlossen. Stillschweigend, versteht sich, zum Sprechen waren wir schließlich beide noch nicht fähig.
Fortan hatten wir uns in der Hand. Fortan saßen wir in einem Boot, ruderten den Strom des Wahns entlang. Jeder von uns konnte das Boot zum Kentern bringen. Doch ertrinken würden wir beide. Unsere Lächeln im Büroflur würden nie wieder unverfänglich sein und nichts weiter als „Guten Morgen!“ oder auch „Montags könnt‘ ich kotzen!“ bedeuten. So sah es aus. Mein Chef fand als erster zur Sprache zurück. „Entschuldigung“, er räusperte sich nochmals. „War keine Absicht!“. Ob er mir denn wehgetan habe? „Nein, nein, außerdem war ich es doch, der rückwärts lief. Guten Tag!“, ich zog meinen imaginären Hut zum Gruße. Noch hatte ich die Tragweite des soeben Geschehen nicht wirklich realisiert, jedenfalls: Wie immer in Momenten der Überforderung lechzte meine Lunge nach einer Zigarette.
Ein „Auf Wiedersehen!“ in Richtung der medizinischen Fachangestellten, mit letzter Kraft öffnete ich die Praxistür. Während ich im Trab die Stufen hinab nahm, prallte ich fast mit drei stiernackigen Hünen in schwarzen Hemden zusammen. In ihren Gürteln steckten Schusswaffen, ich stoppte abrupt und sog die Luft ein. Auch sie schienen nicht mit mir gerechnet zu haben, das Stakkato ihrer schweren Stiefel verstummte. „‘Tschuldigung“, ich überholte rechts. Hinter ihnen schlich in gekrümmter Haltung eine Frau im azurblauen Kostüm, die mir doch nur allzu bekannt vorkam… war das etwa… ja, konnte das denn wirklich sein? Kugelrunde Tränen kullerten über ihre Wangen, ich musterte ihr Gesicht. Das sah mir ganz nach dem Anflug einer Depression aus. „Alle hassen mich! Der Seehofer, die Wagenknecht, der Söder – und der Höcke sowieso!“ Zwar formten ihre Hände längst keine Raute mehr; allenfalls noch eine Ellipse. Doch bestand kein Zweifel mehr: Es war die Kanzlerin, die unter Geleitschutz ihren Weg zu Dr.H. antrat. „Ich werd‘ bekloppt“, dachte ich mir noch, während mir einfiel, dass ich genau das ja nun quasi ganz offiziell war. Schon immer hätte ich lieber nackt auf dem Runden über den Offenbacher Marktplatz gedreht und mir anschließend eine Tube Senf ins Gesicht tätowieren lassen, als mein Kreuz bei der Union zu machen. Frau Merkels zerbrochener Anblick aber ließ mich nun Mitleid empfinden. „SIE SCHAFFEN DAS!“, fand ich aufmunternde Worte und tätschelte der Kanzlerin die Schulter. Die also auch noch.
Die frische Luft tat mir gut. Die Sonne brannte noch immer vom Himmel, ich steckte mir eine Gauloises zwischen die Lippen. Ich würde den Rat des Dr.H. befolgen und das soeben Erlebte irgendwann aufschreiben. Doch schon nach wenigen Schritten in Richtung meines Fahrrades überkamen mich erste Zweifel. Sollte das Schreiben wirklich als Therapie empfohlen worden, wäre dann Charles Bukowski dann je verlegt worden? „Sicher ist sicher“, ich erinnerte mich an die Worte meines seelischen Heilsbringers. Auf dem Heimweg würde ich einen Halt an der Apotheke einlegen und sein Rezept gegen die verschriebene Arznei eintauschen. Ich tastete an meinen Hosentaschen, tastete und tastete – ein Feuerzeug, eine Zigarettenschachtel, Kopfhörer. Sonst aber: Nichts. Dabei war ich mir doch so sicher, das dünne Stück Papier gefaltet und in genau diesen verstaut zu haben!
Oder hatte mich die unverhoffte Zusammenkunft mit meinem sich ebenfalls nicht mehr ganz im Besitz seiner geistigen Kräfte befindlichen Vorgesetzten den Wisch tatsächlich in der Praxis liegen lassen? Noch war ich nicht allzu weit gelaufen; ich kehrte also um. Zurück am unscheinbaren Betonblock, irgendwo im Frankfurter Ostend, suchten meine Augen zum zweiten Mal an diesem Tage den Eingangsbereich nach dem Klingelschild des Psychiaters ab.
Von oben nach unten, von unten nach oben, immer wieder bewegte sich mein Blick über die grauen Schilder aus Plexiglas. Eines mit der Aufschrift „Praxis Dr.H.“ war nicht dabei. Da war nur noch die Nachmittagssonne, die sich in der Fensterfront eines trostlosen Gebäudes im Frankfurter Ostend spiegelte. Ich kehrte um, zündete mir noch eine Zigarette an und ging strammen Schrittes die Straße hinab. Nein, mich wunderte langsam gar nichts mehr.
Ich war wohl wirklich ein echt Crazy Typ.
Wenn auch ihr einmal in einer Krise steckt und euch selbst ein Dr. H nicht mehr zu helfen vermag – dann wendet euch vertrauensvoll an die Selbsthilfe Frankfurt e.v. ! Es ist keine Schande, sich helfen zu lassen. Niemals. Im Gegenteil. Passt auf euch auf.
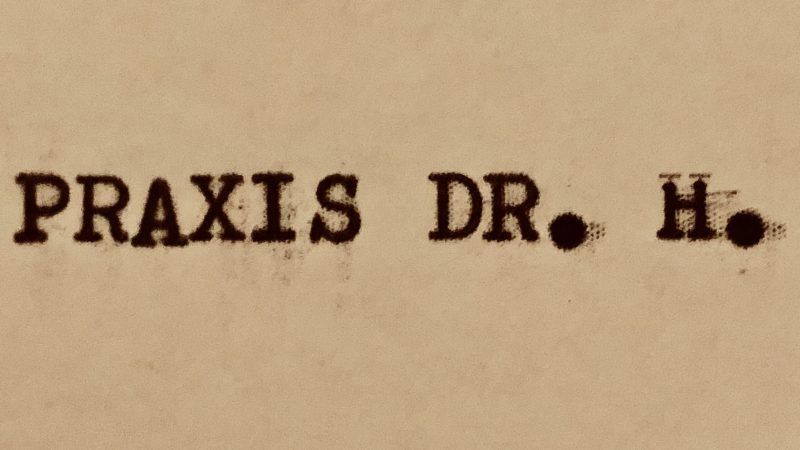



 geklaut von hamburgmuseum.de
geklaut von hamburgmuseum.de eiskalt kopiert von skylineatlas.de
eiskalt kopiert von skylineatlas.de
 (c) mamainessen.de
(c) mamainessen.de
 Bild geklaut bei Wikipedia
Bild geklaut bei Wikipedia




