Um drei Uhr morgens wirkt der Frankfurter Hauptbahnhof in der Regel wie ausgestorben. Nur wenige Nachtzugreisende bevölkern dann die Sitzbänke, selbst für die Bediensteten am Auskunftsschalter gibt es nur wenig zu tun. Bundespolizisten drehen zu Fuß ihre Runden, die Reiniger der Bahn dagegen mit Wischfahrzeugen. Wenn in wenigen Stunden wieder Fahrgäste in die Bahnhofshallen strömen, soll alles blitzblank sein.
In der Nacht auf den 5. Januar 2019 allerdings hat sich eine etwa zwanzigköpfige Schar von Männern in die Szenerie gemischt. Aneinander gedrängt stehen sie am Bahnsteig von Gleis 1a, haben ihre Stative aufgebaut und suchen die beste Belichtungseinstellung für ihre Kameras. Selbst die eisigen Temperaturen haben sie nicht davon abgehalten, einen Abschied festzuhalten, der von den meisten Frankfurtern unbemerkt bleiben dürfte: Mit Abfahrt des FbZ 2475 nach München wird der letzte von einer Lokomotive der Serie „E10“ bespannte Zug der Deutschen Bahn Frankfurt verlassen haben. Damit geht ein über sechs Jahrzehnte andauerndes Kapitel Eisenbahngeschichte zu Ende.
Eine Lok fährt in den Ruhestand
Der Lokomotive, auf die die Eisenbahn-Fans ihre Objektive gerichtet haben, sieht man ihr stolzes Alter an: Im Vergleich zu den windschnittigen Frontpartien der Lokomotiven der Neuzeit wirkt ihr Lokkasten klobig, an einzelnen Stellen blättert der rote Lack ab. Die Pfeife auf dem Dach des Zugpferdes stammt noch aus Dampflokzeiten, statt LED-Scheinwerfern formen drei Glühlampen in der Dunkelheit ein „A“. Längst haben moderne Drehstromlokomotiven ihr den Rang abgelaufen, welche wartungsärmer, wirtschaftlicher und schneller unterwegs sind. In den ersten Tagen des Jahres 2019 ist sie neben einer ihrer Schwestern die letzte sich bei der Deutschen Bahn im Einsatz befindlichen E10.
„Die Lokomotiven der E10-Familie haben meine Leidenschaft für die Eisenbahn entfacht“ – Harald Niggemann, Eisenbahnfreund
Als die Lokomotiven dieser Serie konstruiert wurden, hatte Harald Niggemann das Licht der Welt noch nicht erblickt. Für ihn ist es selbstverständlich ist, freitagnachts am Hauptbahnhof zu stehen, um der altgedienten Zugmaschine „Lebewohl“ zu sagen. Die Lokomotiven der „E10“-Familie, so erzählt er, haben schon zu Kindertagen seine Leidenschaft für die Eisenbahn entfacht. „Meine erste Begegnung mit der ‚Zehner‘ hatte ich im Jahr 1979“, erinnert sich der Frankfurter.

Ein Foto zeigt ihn, wie er im Jahr 1982 aus dem Fenster seiner Lieblingslok blicken und selbst einmal Lokführer spielen durfte. Fast wäre er selbst einer geworden – allein seine Sehkraft hinderte ihn daran, seinen Traumberuf zu ergreifen. „Mit Brille hatte ich seinerzeit keine Chance auf die Lokführerlaufbahn, obwohl ich sämtliche Einstellungstests bestanden hatte“, erzählt der 52-Jährige. Geworden ist er schließlich Kfz-Mechatroniker. Vom Eisenbahn-Fieber ist er aber auch heute noch infiziert. Dass er den Abschied der „E10“ irgendwann erleben würde, sei ihm immer klar gewesen – „jetzt, wo es soweit ist, fühlt es sich aber komisch an“, gesteht der Frankfurter und ist ein wenig traurig.
Was ist das für eine Maschine, die über Jahrzehnte hinweg die Herzen von Eisenbahnfreunden höher schlagen lässt? Merkurist wirft einen Blick zurück.
Das neue Gesicht der Bundesbahn
Im Jahr 1950 beschloss die damalige Deutsche Bundesbahn, im Zuge der fortschreitenden Elektrifizierung ihres Streckennetzes eine Familie neuer Elektrolokomotiven zu entwickeln. Diese sollten nicht nur die bis dato verwendeten Vorkriegs-Maschinen ersetzen, sondern auch neue Maßstäbe hinsichtlich Reisegeschwindigkeit und Ergonomie setzen. So sollte etwa der Lokführer seine Tätigkeit erstmals sitzend verrichten können. Ein Konsortium namhafter deutscher Schienenfahrzeughersteller lieferte schließlich ab dem Jahr 1952 fünf Vorserien-Lokomotiven, aus denen schließlich die Lokomotiv-Baureihe „E40“ für den Güterzugdienst und die der 5030 PS starken „E10“ für den schnellen Personenzugverkehr abgeleitet wurden.
Anfang 1957 war es dann soweit: Die erste E10 wurde von der Industrie an die Deutsche Bundesbahn ausgeliefert. Noch bis zum Jahr 1969 wurden insgesamt 410 Lokomotiven abgenommen, welche schnell das Bild des hochwertigen Reisezugverkehrs bestimmten. Während die Amerikaner auf dem Mond landeten, hatte sich die deutsche Eisenbahn mittels einer großen Anzahl von Neubaulokomotiven völlig neu aufgestellt. Nicht wenige davon wurden im Bahnbetriebswerk Frankfurt am Main 1 beheimatet, das mit ihrer Wartung und Pflege betraut war.
Die zunächst königsblau lackierten Maschinen verbanden die Stadt am Main mit Zielen im gesamten Westdeutschland. Auch die in anderen Bahnbetriebswerken stationierten E10 erreichten während ihrer Reisen regelmäßig das zentral gelegene Frankfurt, sodass der Alltag in dessen Hauptbahnhof recht bald von F- und D-Zügen bestimmt wurde, denen das neue Paradepferd vorgespannt war. Generationen von Lokführern sollten auf der E10 „groß werden“. Und auch, wenn manch Eisenbahnfreund den Dampfloks hinterher trauerte, schlossen Bahnfans die stolzen Maschinen schnell ins Herz.
Mit Tempo 200 in eine neue Zeit
Zunächst für eine Höchstgeschwindigkeit von 140 Stundenkilometern zugelassen, erkannte die Deutsche Bundesbahn recht bald das Potenzial der „E10“. So wurde eine von ihnen mit Schnellfahr-Drehgestellen und einer geänderten Getriebeübersetzung versehen und erreichte im November 1968 erstmals die Geschwindigkeit von 200 Stundenkilometern – damals ein Rekord im Deutschen Streckennetz! Begeistert vom Gedanken, Züge mit schnellen Geschwindigkeiten verkehren zu lassen, orderte die Bundesbahn gleich 31 Lokomotiven, welche den legendären „Rheingold“-Zügen vorgespannt sein sollten. Zu diesem Anlass erhielten sämtliche noch auszuliefernden Lokomotiven ihre charakteristisch geknickte Front, welche ihnen den bis zum heutigen Tag geläufigen Spitznamen „Bügelfalte“ verlieh. Die „Rheingold“-Maschinen erhielten zusätzlich eine Lackierung in Beige mit roter Bauchbinde, passend zu den international verkehrenden Wagen.

Im Jahr 1968 wurde seitens der Bundesbahn ein neues Nummerierung-Schema verfügt. Die 5030 PS starken Serien-Maschinen der Baureihe „E10“ wurden nunmehr als „Baureihe 110“ bezeichnet, die 31 Rheingold-Maschinen als Baureihe 112. Als im Jahr 1971 der neu eingeführte „InterCity“ neue Maßstäbe im Eisenbahnverkehr setzte, oblag den Lokomotiven der „E10“-Familie auch die Bespannung der neuen Paradezüge der Bundesbahn. Hierfür sollte eine neue Farbgebung in blau-beige den Maschinen ein eleganteres Aussehen verleihen. Zwischen Kiel und Basel prägten die „E10“ über Jahrzehnte hinweg das Gesicht der „neuen“ Bundesbahn.
Wechsel zum Nahverkehr
Erst im Jahr 1994 wurden die Lokomotiven der „E10“-Familie im Zuge der Bahnreform aus dem Fernverkehr verbannt und der DB Regio zugeteilt. Dort bildeten sie das Rückgrat des öffentlichen Schienenpersonennahverkehrs – ab 1997 auch im heute bekannten, roten Erscheinungsbild. Wer auch immer von Frankfurt aus in Richtung Saarbrücken, Koblenz, Heidelberg, Kassel oder Fulda reiste, war meist mit einer „Bügelfalte“ unterwegs.

Nachdem aber nach der Wiedervereinigung zahlreiche Eisenbahnstrecken in den neuen deutschen Bundesländern stillgelegt wurden, standen der Deutschen Bahn mehr und mehr Lokomotiven jüngerer Bauart zu Verfügung. Triebfahrzeuge der ostdeutschen Baureihe 143 verdrängten die „110er“ nach und nach von ihrem angestammten Streckennetz, sodass im letztmalig im Jahr 2013 ein planmäßiger Einsatz einer Lokomotive der Baureihe 110 vor einem Nahverkehrszug erfolgte. Auch die Verbindungen rund um Frankfurt wurden auf andere Fahrzeuge umgestellt. Zahlreiche der nun „arbeitslos“ gewordenen E10 wurden im Anschluss einem Wertstoffhändler in Opladen (Nordrhein-Westfalen) zugeführt und gingen den Weg des alten Eisens.
Zweites Leben vor dem Autoreisezug
Anfang des neuen Jahrtausends verloren nochmals zahlreiche Maschinen ihre Einsatzgebiete an die modernen Triebzüge privater Betreiber. Als abzusehen war, dass ein Großteil der „110er“ im Nahverkehr nicht mehr benötigt wurde, nutzte die Autozug-Sparte der DB Fernverkehr die Gunst der Stunde und erwarb einige der nunmehr fast 50 Jahre alten Maschinen. Da die Lokomotiven nach wie vor als zuverlässig galten und die Autoreisezüge ohnehin mit lediglich 140 Stundenkilometern unterwegs waren, galten sie als optimale Zugmaschinen für die Langläufer. Zur Unterscheidung zur Baureihe 110 des Nahverkehrs wurden sie zur Baureihe 115 umgenummert. Auch auf der „Gäubahn“ zwischen Stuttgart und Singen halfen sie häufig für die dort ohnehin recht langsam verkehrenden „InterCity“-Züge aus.

Dass der Autoreisezugverkehr der Deutschen Bahn AG zum Fahrplanwechsel 2017 schlussendlich eingestellt wurde, ist nicht den Lokomotiven anzulasten. Der Höhenflug der Billigfluglinien sowie die fallenden Preise im Mietwagenmarkt sorgten dafür, dass nur noch wenige mit dem eigenen Auto „huckepack“ auf einem Zug in den Urlaub fahren wollten. So wenige, dass sich das Geschäft für die Deutsche Bahn nicht mehr lohnte und kurzerhand eingestellt wurde. Abermals hatten die E10 ein angestammtes Einsatzgebiet verloren. Bis zuletzt übrig blieben für die einstigen Paradepferde allein die Überführungsfahrten, welche während der Nachtstunden Schadwagen den im Bundesgebiet angesiedelten Werkstätten zuführen.
Ein recht beschaulicher Arbeitsaufwand: Im Jahr 2018 war die Menge von einst 430 Maschinen bereits auf eine an zwei Händen zählbare geschrumpft. Als zum Fahrplanwechsel am Ende des Jahres dann zahlreiche IC-Zugpaare mit neuausgelieferten „IC2“-Garnituren statt mit dem Ende der Achtzigerjahre gelieferten Lokomotiven der Baureihe 120 gefahren wurden, beschloss die Deutsche Bahn, die Bespannung der Überführungsfahrten der 120 zu übertragen. Somit war das Ende der „E10“ im Einsatz bei der DB besiegelt.
Langsamer Tod: Eine Ära geht zu Ende
Zurück zum Gleis 1a des Frankfurter Hauptbahnhofs. Die Eisenbahnfreunde fachsimpeln und tauschen Erinnerungen aus. Eine dunkle Silhouette im Führerstand trifft letzte Vorbereitungen, schließlich wird das Ausfahrsignal frei. Auslöser klicken, als die Fahrmotorlüfter der alten Maschine anlaufen und sich ihre 86 Tonnen in Bewegung setzen. Am Zughaken hat die 115 198 – so ihre genaue Bezeichnung – Schadwagen, die sie heute zum letzten Mal ins Werk nach München bringen wird. Es wird ihre letzte Reise sein. Am Ziel angekommen, führt für sie die Fahrt aufs Abstellgleis.

In der folgenden Nacht wird dann nach über 61 Jahren der planmäßige Einsatz von E10 bei der Deutschen Bahn dann nicht nur in Frankfurt, sondern endgültig Geschichte sein. Fast mutet es ironisch an, dass die letzt verbliebene Vertreterin der Lok-Legende auf ihrer Abschiedsfahrt einen defekten – wenn auch hochmodernen – ICE ins Krefelder Ausbesserungswerk schleppen soll, wo dieser repariert wird. Ihre eigenen Stromabnehmer werden sich danach allerdings für immer senken.
115 198 nimmt nun an Fahrt auf, bald ist der FbZ 2475 nach München im Gleisgewirr des Vorfelds verschwunden. Die Stimmung unter den Fotografen ist bedrückt. Eine E10 können sie in Zukunft nur noch im Museum bewundern. Auch Harald Niggemann packt seine Kamera ein. „Das war’s dann wohl“, sagt er. In Zukunft will er so oft es geht Lokomotiven die Drehstromlokomotiven der Baureihe 120 fotografieren. „Wer weiß, wie lange die noch fahren werden.“


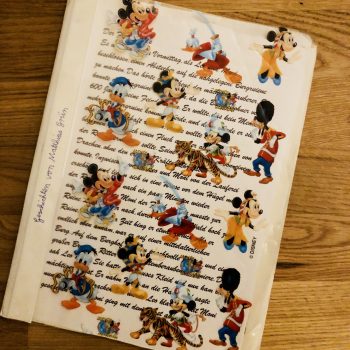 Ja, im Jahr 1997 hatte ich sowohl Mädchen als auch Fußballspielen als ziemlich doof empfunden, da konnte auch Papa nix machen. Auch der Carrerabahn konnte ich nie viel abgewinnen. Wohl aber meiner Phantasie, welche gelegentlich mit mir durchging und mich Geschichten namens “Tina im Orient” oder “Ein Drache als Haustier” zu Papier bringen ließ.
Ja, im Jahr 1997 hatte ich sowohl Mädchen als auch Fußballspielen als ziemlich doof empfunden, da konnte auch Papa nix machen. Auch der Carrerabahn konnte ich nie viel abgewinnen. Wohl aber meiner Phantasie, welche gelegentlich mit mir durchging und mich Geschichten namens “Tina im Orient” oder “Ein Drache als Haustier” zu Papier bringen ließ. Irgendwann dann erreiche ich dann doch noch mein Ziel, checke im Hotel ein, entledige mich meines Trolleys und schaufele mir einen Liter kaltes Wasser ins Gesicht. Ab aufs Fahrrad, ich bin gespannt und aufgeregt!
Irgendwann dann erreiche ich dann doch noch mein Ziel, checke im Hotel ein, entledige mich meines Trolleys und schaufele mir einen Liter kaltes Wasser ins Gesicht. Ab aufs Fahrrad, ich bin gespannt und aufgeregt! Diese Frage wird beantwortet, als die beiden Moderatoren pünktlich die Bühne betreten und die Show beginnt. Zu meiner Erleichterung ist kaum ein Platz im Publikum leer geblieben, ich zähle zahlreiche Biere auf den Tischen, hoffe auf ein nach dem dritten Pils bereits sehr nachsichtiges Publikum.
Diese Frage wird beantwortet, als die beiden Moderatoren pünktlich die Bühne betreten und die Show beginnt. Zu meiner Erleichterung ist kaum ein Platz im Publikum leer geblieben, ich zähle zahlreiche Biere auf den Tischen, hoffe auf ein nach dem dritten Pils bereits sehr nachsichtiges Publikum. “Willst du dich im hohen Gras verstecken? Dann lese weiter auf Seite 17. Oder doch lieber hinter dem Felsen? Dann geht es weiter auf Seite 21” – ein herrlich-schräges Abenteuer, wie es nur eine noch junge Seele zu Papier bringen kann. Mir unbegreiflich, wie Sarah beim dicken Papierstapel in ihrer Hand den Durchblick behält.
“Willst du dich im hohen Gras verstecken? Dann lese weiter auf Seite 17. Oder doch lieber hinter dem Felsen? Dann geht es weiter auf Seite 21” – ein herrlich-schräges Abenteuer, wie es nur eine noch junge Seele zu Papier bringen kann. Mir unbegreiflich, wie Sarah beim dicken Papierstapel in ihrer Hand den Durchblick behält.


























