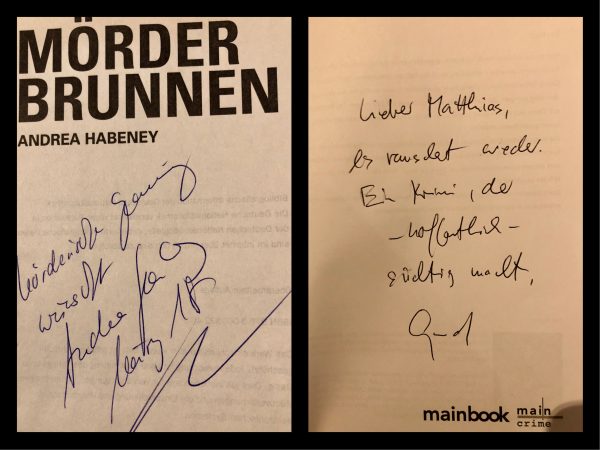Leidenschaften zu haben ist gut. Leidenschaften miteinander zu verbinden ist besser! Insofern bin ich fast ein wenig verärgert darüber, dass mir eine wahrlich grandiose Idee vorweggenommen wurde….
Aufmerksame Mainrausch-Leser wissen natürlich längst um meine Vorliebe für Fahrradtouren, Literatur und Wasserhäuschen. Was also sollte schon näher liegen, als diese wesentlichen Aspekte meines bescheidenen Daseins zu kombinieren? Eben.
Ärgerlicherweise – ich habe es erwähnt – kamen mir einige helle Köpfe der Jugendmigrationsdienste im Quartier Gallus kurzerhand zuvor, in dem sie in Zusammenarbeit mit dem Stadtbiotop Offenbach sowie die astreinen Jungs des Wasserhäuschen-Fanclubs Linie 11 eine – Achtung, Wortspiel! – LiteRadTour ersannen.
Texte treffen aufs Trinken, Rhetorik trifft aufs Radfahren, so das Motto der Veranstaltungsreihe für das breite Volk. Nach drei Versuchen, welche vollends an mir vorüberzogen, gelang es den Initiatoren beim vierten Anlauf, mich auf die nächste bevorstehende Radtour mit Zwischenstationen in Form von poetischen Darbietungen aufmerksam zu machen. Die Künstler des Tages: Jan Cönig und Raban Lebemann vom gleichnamigen Duo, außerdem der mir bis dato unbekannte Gax Axl Gundlach. Außerdem, als Krönung des Ganzen: Jey Jey Glünderling, mit Preisen quasi überschütteter Meister des Poetry Slam. Seine Texte hab’ ich schon immer sehr gefeiert (sagt man heute so!), kurzum: Ich war vom Rahmenprogramm vollends überzeugt.Ein heißer Sonntag im August 2018 soll zum Tage des Spektakels werden. Und dieses Mal -endlich-endlich!- bin auch ich mit von der Partie. Als Otto-Stinknormal-Teilnehmer, wie schön, auf der Bühne habe ich selbst schließlich erst am vergangenen Sonntag gestanden. Einfach mal berieseln lassen: Nice!
Ziemlich nice auch, dass ich ich eine bezaubernde Begleitung gefunden habe, die sich mit mir auf zwei Rädern auf den Weg mitten hinein ins Herz Frankfurts verzogener, kleiner Schwester macht: Offenbach. Offenbach, das meint man gar nicht, ist -rein räumlich betrachtet- tatsächlich an manchen Stellen lediglich eine nahtlose Fortsetzung des Frankfurter Stadtgebietes. Wir sind schnell da, just-in-time, ja, auch Offenbacher Straßenzüge haben ihre Tücken.
Erster Akt: Ein Marktplatz ohne Markt
 Kaum haben wir den Treffpunkt erreicht und unsere Zweiräder verschlossen (in Offenbach weiß man ja nie!), müssen wir uns arg wundern. Einen “Marktplatz”, den hätten wir uns, nun ja, anders vorgestellt: Keine Spur von Marktbuden und freundlich dreinblickenden Damen in grünen Kittelschürzen, welche mit einem herzlichen Lächeln im Gesicht den Bund Möhren überrascht.
Kaum haben wir den Treffpunkt erreicht und unsere Zweiräder verschlossen (in Offenbach weiß man ja nie!), müssen wir uns arg wundern. Einen “Marktplatz”, den hätten wir uns, nun ja, anders vorgestellt: Keine Spur von Marktbuden und freundlich dreinblickenden Damen in grünen Kittelschürzen, welche mit einem herzlichen Lächeln im Gesicht den Bund Möhren überrascht.
Auch von eher halbseidenen Geschäften keine Spur, keine bösen Gesichter hinter Sonnenbrillen, keine Plastiktütchen. Verdammt, wird an Offenbacher Marktplätzen überhaupt irgendwas gehandelt? Stattdessen: Betongraue Tristesse, eine KFC-Filiale, und eben: Die Literaten, umringt von ihrer etwa dreißigköpfigen Zuhörerschaft. Und eben uns.
“Schön, dass ihr da seid!”, oha, es geht los. Eine junge Vertreterin des Offenbacher Stadtbiotops begrüßt die Angereisten, ja, man habe sich bewusst für diesen Ort entschieden. Das durchaus unterstützenswerte Ansinnen der Initiative sei es schließlich ausdrücklich, auch trostlose Orte wie diesen hier zu bespielen, mit Leben zu füllen. Und dann geht’s auch schon los!
Jan Cönig spricht zuerst ins Mikrofon, seine durch einen tragbaren Verstärker potenzierte Stimme lockt erste Schaulustige an. Es folgt ein Text seines Partners Lebemann, er referiert über die Ernährungsgewohnheiten der Generation Instagram. “Gax” Axel Gundlach gelingt es anschließend, eine Spur Tiefsinn auf dem grauen Pflaster zu versprühen. Bühne frei für Jey Jey Glünderling, ja, selbst an diesem unwirtlichen Ort weiß er sich als Kunstfigur zu inszenieren. “Wie nennt man man ein kiffendes Känguruh?”, versucht er sich zunächst an einem kleinen Kalauer und lässt die Antwort nicht lange auf sich warten: “Grashüpfer!” Erwartungsgemäß, so soll es bei Kalauern schließlich sein, lacht niemand. Mir entweicht dennoch ein kurzes Kichern, “hat ein bisschen gedauert, was?”, fragt der Poet in meine Richtung. In gewohnter Manier – folglich ziemlich laut, wofür hat der Kerl eigentlich ein Mikrofon?, knüpft er seinen eigentlichen Text an. Nun lachen alle, der Kerl versteht sein Handwerk.
Ein zu uns gestoßener Passant weiß nicht nur jedes Offenbach-Klischee zu erfüllen, sondern scheint dagegen eher weniger von Sinn und Zweck der Veranstaltung zu verstehen. “Poetry? Ey, hab’ ich nie was von gehört, nee, nich’ so meins, Bruder!” Wer schon hätte das gedacht. Zeit für einen Ortswechsel. Ein Becher Kaffee für den Weg, nächster Halt: Dreieichpark. An den Ort, an dem sich Welse ihrer Artgenossen entledigen und Sommerlöcher füllen. Wir sind gespannt und treten in die Pedale.
Zweiter Akt: Barocke Tempel treffen Freestyle-Skills
Ein knapper Kilometer später, der Kaffee blubbert in meinem Magen. Wir haben den Dreieichpark erreicht, ein Sommertag in Offenbach, Kinder toben und schreien, wir suchen Schutz unter dem Dach des barocken Pavillons. Dieser ist -ganz klar, Offenbach!- natürlich videoüberwacht, vielleicht finden ja hier diejenigen Geschäfte Stadt, welche man auf dem Marktplatz verortet hätte. Wir versammeln uns im Halbkreis um die Literaten, erste Bier- und Wodkaflaschen werden umhergereicht. Scheint in literarischen Freundeskreisen üblich, da kann ich mich als Autor nicht einmal ausklammern. Bleibe aber, so beschließe ich, vorerst dennoch bei ‘ner kalten Cola Light.

In bekannter Reihenfolge gibt’s was auf die Ohren und zum Denken, zuletzt betritt Glünderling die Bühne, welche keine ist. Er verliest seinen Text über einen recht unbeliebten Schüler, schnell erkenne ich ihn wieder – ist dieser doch bereits in Jey Jeys Erstlingswerk veröffentlicht. Der Text beginnt recht harmlos, entwickelt sich aber nach recht radikalem Umbruch zu einer wahnwitzigen Werbung für Scientology. Nicht, dass der Autor das ernst meinen würde, doch versteht er es eben auch auf improvisierten Bühnen, so richtig auszurasten: “Werde Teil von Scientology!”, am Ende spricht er nicht, er schreit. So laut, dass auch ein -abermals jegliche Klischees erfüllender- Parkbesucher sich erschreckt umdreht. Etwas verstört mustert er unsere Versammlung und beginnt zu schimpfen. “Entspann’ dich mal, und komm’ auch du zu Scientology!”, ruft Glünderling ihm zu. Die Zuhörer lachen, der Offenbacher nicht. Er zieht von dannen.
 Bevor wir allerdings von dannen ziehen, gibt’s allerdings noch ein wenig Freestyle-Rap der Künstler. Ich kenn’ das schon als Einlage von “Wir müssen reden, Frankfurt!”, auch dieses Mal bin ich angetan vom Improvastionstalent der Jungs. Auf vom Publikum ein- beziehungsweise nicht eingeworfene Stichwörter (na gut, nehmen wir halt ‘Stille’!”) mal eben einen Sprechgesang zu fabrizieren- Chapeaux!
Bevor wir allerdings von dannen ziehen, gibt’s allerdings noch ein wenig Freestyle-Rap der Künstler. Ich kenn’ das schon als Einlage von “Wir müssen reden, Frankfurt!”, auch dieses Mal bin ich angetan vom Improvastionstalent der Jungs. Auf vom Publikum ein- beziehungsweise nicht eingeworfene Stichwörter (na gut, nehmen wir halt ‘Stille’!”) mal eben einen Sprechgesang zu fabrizieren- Chapeaux!
Rucksäcke werden gepackt und Fahrräder bestiegen, denn: Wir ziehen weiter. Zurück nach Frankfurt, home sweet home, nächster Halt: Gallusviertel. Noch ehe wir die Oberräder Wiesen erreichen, hat sich die vormals dreißigköpfige Gruppe verloren, was soll’s, sind ja alle groß. Am Mainufer versuchen wir geflissentlich, Passanten einen tödlichen Ausgang ihres Sonntagsspazierganges zu ersparen, passieren das Heizkraftwerk West, und erreichen: Irgendwann doch unsere nächste Station: Die Trinkhalle Kölner Straße, “hart-klassisch” gemäß der amtlichen Trinkhallen-Definition meiner Freunde der Linie 11.
Dritter Akt: Von Verlorenen und Kirschlikör
Irgendwann erreichen wir dann doch noch die berüchtigte Trinkhalle. Auch hier die Drahtesel besser mal angekettet. Gundlach ist schon vor uns im Gallus angekommen, zählt aber nicht, statt mittels Velo war er mit Motorroller unterwegs. “Reifen war platt!”, entschuldigt er sich. Wir freuen uns über die Vollzähligkeit der Künstler. Eine Vollzähligkeit, wie man sie von den Zuhörern nicht behaupten kann: Die einst dreißig Teilnehmer haben sich kurzerhand halbiert. Was ihnen innerhalb der letzten Dreiviertelstunde zugestoßen sein mag? Darüber lässt es sich nur mutmaßen.
Doch zuerst gilt es sich zu erfrischen, meine adrette Begleitung und ich mustern die Auslage der Trinkhalle. “Höhö”, sag’ ich, “schau’ mal da: Kirschlikör!”. Kurz liebäugeln wir mit Eierlikör, entscheiden uns dann dennoch zum Kauf. Tarnung ist alles, das weiß man auch im Gallus – es gilt nun galant, den Inhalt der kleinen Likörflasche in einer unverdächtig wirkenden Cola-Flasche zu versenken.Nicht namentlich zu nennende Teilnehmer und Künstler geben sich da weitaus unverschämter: Nicht mal sechs Uhr abends, abermals machen Bier-, Club-Mate- und Wodkaflaschen die Runde. Cheers, Gallus – und: Bühne frei!
Cönig berichtet von seinen fingierten Erlebnissen als Treppenlift-Fahrer und Kindergeburtstags-Clown. Glünderling kotzt sich aus über die geschlechtsspezifischen Benachteiligungen der Herrenwelt im Hochsommer, zwischen den Zeilen plädiert er aber für ein frei von Hochglanz-Magazinen geprägtes Schönheitsideal. I like!

Gundlach startet was dadaistisches, was genau, vergesse ich schnell. Dadaismus war noch nie so Meines, dafür aber Trinkhallen – respektive die bunte Vielfalt der Frankfurter Wasserhäuschen-Szene.
“Ey, lest hier mal bloß nix vor!”, ein Kerl im Unterhemd ist offensichtlich kein Freund der lokalen Literatur. Was soll’s, ich nippe an meiner mit Kirschlikör aufgemotzten Cola. Schmeckt gar nicht mal so übel – dass es immer noch erst früher Abend ist, ignoriere ich dabei geflissentlich. Am Sonntag ist das legitim, lasse ich mich von der jungen Frau zu meiner Rechten belehren.
Nur schweren Herzens lösen wir uns aus unseren Trinkhallen-Stühlen, einmal noch aufs Rad, die Endstation für heute ist nicht weit: Die Quäkerwiese, grünes Einod des einstigen Arbeiterviertels.
Vierter Akt: Speed-Dating und schwarze Löcher
Nur einen Katzensprung später, die Räder sind verschlossen, eine Mauer bietet eine Sitzgelegenheit, die wir dankbar annehmen. Schnell haben sich die Autoren eine letzte Bühne für den heutigen Tag herbei-improvisiert. Sind tatsächlich schon vier Stunden vergangen?
Wir wechseln von Kirschcola zum Käffchen und sind noch mal ganz Ohr. Gundlach kündigt einen guten Rat fürs Leben an, beginnt seinen Text aber zunächst mit einem interstellaren Ausflug. Supernova, rote Riesen, Universum weg, Sonne weg, alles weg, schnell gleite ich in Gedanken ab und kann nicht mehr wirklich folgen. Hätte wohl doch Raketenwissenschaftler werden sollen.
Doch, a propos schwarzes Loch: Sind darin etwa die zwei Drittel der einst dreißig Literaturfreunde entschwunden? Wir haben uns deutlich dezimiert, was soll’s, wir hören weiter zu. Gundlach nähert sich der Pointe, dem Rat fürs Leben, der da lauten soll: “Lebt so, dass euer letzter Gedanke sein wird: Scheiße, war das Leben geil!”. Wie recht er doch damit hat.

Lebemann greift zum Mikrofon, lässt sein letztes, fiktives Speed-Dating mit uns Revue passieren. Ganz witzig, wirklich, am Ende wird ein für alle Male klargestellt: Ja, die “Achtzehn” fährt auch in die Innenstadt.
Welch ein starker Sonntag!
Und wir? Sagen tschüß und fahren statt in die Innenstadt ins schöne Bornheim. Da gibt’s nämlich Lavendel-Minze-Apfelwein und obendrein eine tolle Aussicht hinab vom Hof des Bornheimer Ratskellers (no advertising!).

Wir stoßen an, noch immer ist es hell. Doch schließlich ist es Sonntag.
Und wir beide sind uns einig: Ein ziemlich starker Sonntag. Auf baldiges Wiedersehen bei der nächsten “LiteRadTour”!
 Um uns herum haben wir bereits andere Teilnehmer der “Silent Disco” entdeckt.Im Gegensatz zu uns konnten sie bereits einen der großen Kopfhörer ergattern und tanzen der Nacht entgegen. Sie schauen ein wenig skurril aus, die großen Lauscher auf ihren Köpfen erinnern uns an Mickey-Mäuse. Mit beschwingten Hüften bewegen sie sich auf dem Gelände herum, was draußen ein wenig eigenartig wirkt: Dort ist von Musik nämlich nichts zu hören; ein Jeder tanzt gewissermaßen zu seiner ganz persönlichen Live-Übertragung von der Tanzfläche im Pavillon.
Um uns herum haben wir bereits andere Teilnehmer der “Silent Disco” entdeckt.Im Gegensatz zu uns konnten sie bereits einen der großen Kopfhörer ergattern und tanzen der Nacht entgegen. Sie schauen ein wenig skurril aus, die großen Lauscher auf ihren Köpfen erinnern uns an Mickey-Mäuse. Mit beschwingten Hüften bewegen sie sich auf dem Gelände herum, was draußen ein wenig eigenartig wirkt: Dort ist von Musik nämlich nichts zu hören; ein Jeder tanzt gewissermaßen zu seiner ganz persönlichen Live-Übertragung von der Tanzfläche im Pavillon.  Der Autor hat sichtlich Freude.
Der Autor hat sichtlich Freude. 


 Ein ganz normaler “STOFFEL”-Abend
Ein ganz normaler “STOFFEL”-Abend
 Theater, Freunde, Apfelwein: Auf der “Sommerwerft”
Theater, Freunde, Apfelwein: Auf der “Sommerwerft”


 Kurz verfalle ich zurück in rosarote Freibad-Nostalgie. Doch rein objektiv betrachtet liegt hier schlicht ein Um-die-Dreißiger auf einer karierten Decke inmitten einer Großstadt. Ein Erwachsener, der im Supermarkt gesiezt wird und keine Schülerausweise mehr fälschen muss, um Apfelwein zu kaufen.
Kurz verfalle ich zurück in rosarote Freibad-Nostalgie. Doch rein objektiv betrachtet liegt hier schlicht ein Um-die-Dreißiger auf einer karierten Decke inmitten einer Großstadt. Ein Erwachsener, der im Supermarkt gesiezt wird und keine Schülerausweise mehr fälschen muss, um Apfelwein zu kaufen.